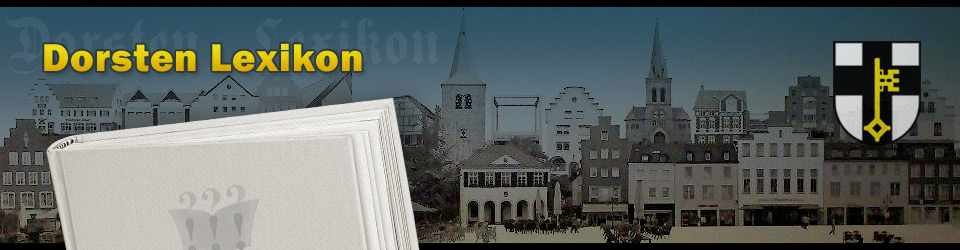Wenn nichts mehr geht: Mit Vertrauensfragen vorzeitige Neuwahlen auslösen
Koalitionsbrüche, Minister-Rausschmisse, verlorene Nerven und auch etwas Taktik – mit Stand von 2024 haben Kanzler dreimal per Vertrauensfragen vorzeitige Neuwahlen ausgelöst. Nach Willy Brandt, Helmut Kohl und Gerhard Schröder stellte am 16. Dezember 2024 Olaf Scholz die Frage aller Fragen. – Drama war immer. Schwere Vorwürfe, Enttäuschung, die Erzählung von Verrat, Lüge, Trickserei, Beschimpfungen und Beteuerungen. Es gab Warnungen vor Schaden für die Demokratie, Klagen, Gerichtsentscheidungen – so ist die Geschichte der verfrühten Parlamentsauflösungen in der Bundesrepublik. Dreimal ist es bisher dazu gekommen, jedes Mal war die Vertrauensfrage des amtierenden Bundeskanzlers das Mittel zur Neuwahl. Zum vierten Mal wird sie an diesem Montag gestellt. Diesmal ist Olaf Scholz an der Reihe mit diesem im Artikel 68 des Grundgesetzes festgehaltenen Konstrukt, das dort den Titel „Auflösung des Bundestages“ trägt, als Vertrauensfrage bezeichnet wird und doch eigentlich eine Misstrauensfrage ist. Denn der Kanzler fragt die Abgeordneten nach dem Vertrauen und will erreichen, dass sie es ihm nicht zusprechen, zumindest nicht mehrheitlich. Auf diese Weise lässt sich dann eine Neuwahl erreichen.
Bundeskanzler Willy Brandt behalf sich samit erstmals 1971
1972, die Bundesrepublik war gerade 23 Jahre alt. Seine sozialliberale Koalition war wegen ihrer sogenannten Ostpolitik in Schwierigkeiten geraten, dem Bemühen um Entspannung mit der Sowjetunion und anderen Staaten des Warschauer Paktes wie Polen. „Wandel durch Annäherung“ ist Brandts Maxime. In Warschau kniet er vor dem Denkmal für das Warschauer Ghetto nieder, eine symbolische Bitte um Vergebung für die NS-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. In den Blick genommen wurde die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als deutsch-polnische Grenze, was einen Verzicht auf einst zum Deutschen Reich gehörende Gebiete wie Schlesien und Westpreußen bedeutete. Der Union und einigen Nationalliberalen in der FDP ging das zu weit. Mehrere FDP-Abgeordnete verließen die Partei. Einige, darunter der frühere FDP-Chef Erich Mende wechselten zur Union. Auch ein SPD-Vertriebenenpolitiker gab sein Parteibuch ab.
Der Spott von Franz Josef Strauß
Die Union scheiterte zwar mit dem Versuch, Brandt über ein konstruktives Misstrauensvotum durch den CDU-Chef Rainer Barzel zu ersetzen. Aber im Bundestag mit seinen damals nur drei Fraktionen gab es nun ein Patt. Handlungsfähig war die Koalition damit nicht mehr – eine Mehrheit für den Haushalt fand sich nicht. Nach den Olympischen Spielen, die durch das Attentat von Palästinensern auf israelische Sportler zu einem ganz eigenen Drama wurden, griff er zu dem Mittel, das, wie er befand, nicht „mit der Elle der Tagespolitik“ zu messen sei: Er stellte die Vertrauensfrage und stellt seine Niederlage sicher, indem seine Minister der Abstimmung fernblieben. Die Union hatte kein Problem mit einer Neuwahl. Sie befand aber, der Kanzler müsse zurücktreten. Sie argumentierte mit Verfassungsrecht. Aber Parteitaktik schwang mit: Rücktritt war dann doch so was wie ein Makel. „Der Bundeskanzler hat keine Mehrheit mehr, ordnet aber an, dass er die Vertrauensfrage verliert“, spottete CSU-Chef Franz Josef Strauß in der Bundestagsdebatte am 22. September 1972. Der gerade gescheiterte Barzel sprach nun vom Scheitern Brandts. Der entgegnet mit Schärfe: Die Union rede das Land schlecht, die Wähler müssten sich nun entscheiden zwischen den „Kräften für konservative Beharrung“ und den „Kräften für mehr Erneuerung“. Sein Koalitionspartner, FDP-Chef Walter Scheel, schwärmte von Brandts „Verantwortungsgefühl, Gerechtigkeitssinn und Fairness“. Brandt verlor die Vertrauensfrage klar. Ziel erreicht, es folgte ein Willy-wählen-Wahlkampf, bei der Wahl triumphierte die SPD.
Helmut Schmidts Wutausbruch
Zehn Jahre später berief sich ein CDU-Politiker auf ihn: Helmut Kohl hatte durch ein konstruktives Misstrauensvotum im Oktober 1982 SPD-Kanzler Helmut Schmidt abgelöst – die FDP unter ihrem Chef Hans-Dietrich Genscher, die im Bundestagswahlkampf offensiv für ein erneutes sozialliberales Bündnis geworben hatte, hatte nach zwei Jahren die Seiten gewechselt. Wie heute gab es Streit um die Wirtschaftspolitik, in der SPD kam Ärger um die Stationierung von US-Atomwaffen im Rahmen des Nato-Beschlusses dazu. Im Februar hatte Schmidt seine Koalition mit einer Vertrauensfrage diszipliniert, lange gehalten hat das nicht. Empörung und Bitterkeit zogen sich durch die Bundestagsdebatte zum Misstrauensvotum. „Noch habe ich das Recht, hier zu reden“, brüllte Helmut Schmidt offenkundig angefasst in den Plenarsaal und schwang die Faust durch die Luft. Es waren die letzten Stunden seiner Kanzlerschaft. Der bisherige Innenminister Gerhart Baum (FDP) beklagte, seine Partei mache der Union nun Zugeständnisse, die sie der SPD verweigert habe. Die bisherige Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Hildegard Hamm-Brücher (FDP), sprach enttäuscht vom „Odium verletzten demokratischen Anstands“. CDU-Generalsekretär Heiner Geißler gab zurück, diese Einordnungen seien „ein Anschlag auf unsere Verfassung“. Die Vorsitzende des Finanzausschusses, Ingrid Matthäus-Maier, und FDP-Generalsekretär Günter Verheugen verließen ihre Partei. „Die schwierigste politische Entscheidung meines ganzen Lebens“, so nannte Verheugen das im Interview. „Es hat damals die Partei zerrissen.“ Matthäus-Maier sagte, der Ruf der FDP sei „auf Jahre beschädigt“ gewesen.
FDP wechselt zu Helmut Kohl
Nach dem Kanzlerwechsel gab sich die neue schwarz-gelbe Koalition ein Rumpfprogramm. Kohl sprach von einer „außergewöhnlichen Notlage“, man müsse erst mal einen Haushalt verabschieden. Die Notlage erledigte sich nach zwei Monaten, Union und FDP verkündeten, ihr Programm sei abgearbeitet. Die Mehrheit von Schwarz-Gelb wart noch da, dennoch erhielt Kohl bei seiner Vertrauensfrage am 17. Dezember 1982 nur 1,6 Prozent Zustimmung. Die große Mehrheit der Unions- und FDP-Parlamentarier enthielt sich. So war es vereinbart. Er habe „alles vermieden, was den Anschein des Künstlichen oder der Manipulation erwecken könnte“, verkündete Kohl und war offenbar doch ein wenig aufgeregt: Er verlegte das Datum seiner ersten Regierungserklärung auf Monate vor den Regierungswechsel. Parteichef Brandt bescheinigte ihm etwas erschöpft „robuste Dickfelligkeit“. Das Bundesverfassungsgericht wies Klagen von vier Abgeordneten – von CDU, FDP und eines Parteilosen – zurück. „Ein krasses Fehlurteil“, so sah Verheugen das. „An dieser Stelle ist eindeutig die Bestimmung des Grundgesetzes umgangen worden, dass der Bundestag kein Selbstauflösungsrecht hat.“ Das Vorgehen bekam den Namen: „unechte Vertrauensfrage“. In den Wahlkampf konnte Kohl nun mit etwas Kanzlererfahrung ziehen, die FDP bewarb sich als Regierungspartei und nicht als eine, die eine Regierung gerade verlassen hatte. Bis zur nächsten Vertrauensfrage dauerte es dann etwas länger: Gerhard Schröder beendete damit 2005 seine dritte Amtsperiode. Seine Agenda 2010 mit ihren Einschnitten ins Sozialsystem hatte heftigen Unmut ausgelöst.
Gerhard Schröder nahm Schlafmittel in der Wartezeit
Das neue Arbeitslosengeld II wurde unter dem Stichwort Hartz IV zum Symbol für Abstiegsängste. Es gab Demonstrationen, die SPD-Linke protestierte, die SPD verlor mehrere Landtagswahlen. Schröder hatte deswegen bereits den Parteivorsitz an Fraktionschef Franz Müntefering abgegeben. Als im Frühjahr 2005 die SPD das traditionell von ihr regierte bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen an die Union verlor, kündigt Schröder Neuwahlen an. Schröder gab sich nach außen weiter cool, aber leicht fiel ihm die Sache offenbar nicht. In den Wochen bis zur Vertrauensfrage im Juli habe er erstmals Schlafmittel genommen, schrieb der Historiker Gregor Schöllgen in seiner Schröder-Biografie. Er könne „nicht mehr auf das notwendige, auf stetiges Vertrauen rechnen“, so begründete der Kanzler dann seinen Antrag im Bundestag am 1. Juli 2005. Oppositionsführerin war damals CDU-Vorsitzende Angela Merkel, die ankündigte, sie werde als Kanzlerin „durchregieren“. Doch zunächst erreicht Schröder sein Ziel. Ein Teil der SPD-Abgeordneten enthielt sich. Der Grünen-Abgeordnete Werner Schulz sprach von einem „würdelosen Abgang“ und einem „Tiefpunkt der Demokratie“. Auch seine Klage, gemeinsam mit einer Sozialdemokratin, scheiterte vor dem Bundesverfassungsgericht.
Vorsichtsmaßnahme der Grünen
In den hinteren Reihen des Plenarsaals verfolgten die Debatte im Jahr 2005 auch der abrüstungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion und der FDP-Sprecher für Weinbaupolitik. Heute sind beide zentrale Figuren der Bundespolitik: Rolf Mützenich musste als SPD-Fraktionschef mit sicherstellen, dass bei der Abstimmung alles lief. Verkehrsminister Volker Wissing hatte mit dem Aus der Ampelkoalition die FDP verlassen und seiner Ex-Partei den Vorwurf fehlenden Kompromisswillens gemacht. Am 6. November zerbrach die Ampel nach monatelangem Streit um den Haushalt in einer Zeit, in der der Angriff Russlands auf die Ukraine enorme Zusatzausgaben verursacht und die Wirtschaft extra belastet. Scholz hatte schließlich Bundesfinanzminister Christian Lindner, den FDP-Chef, aus dem Kabinett geworfen. Er hatte ihm Vertrauensbruch und Kleinkariertheit vorgeworfen. Inzwischen ist ein Papier bekannt geworden, wonach die FDP den Bruch schon eine Weile geplant hatte. Die verbliebene Regierung aus SPD und Grünen hatte keine Mehrheit mehr. Dennoch hat die Grünen-Fraktion angekündigt, sich bei der Abstimmung zu enthalten – sicher ist sicher.
Wird Bundeskanzler Scholz am 23. Februar 2025 wieder gewählt?
Wenn Bundestagspräsidentin Bärbel Bas das Abstimmungsergebnis verkündet, wird Scholz auf den Kabinettsbänken sitzen, auf dem Kanzlerstuhl mit der erhöhten Rückenlehne. Brandt hatte die Verkündung 1972 mit ernstem Blick verfolgt. Kohl gönnte sich 1982 ein leichtes Lächeln. Schröder schüttelte 2005 seinem Außenminister Joschka Fischer (Grüne) die Hand und verließ dann den Plenarsaal, zügig, ohne weiteres Geplänkel. Die anschließende Bundestagswahl hat er knapp verloren. Brandt und Kohl wurden nach ihren Vertrauensfragen erneut Kanzler. Wie es Scholz ergeht, entscheidet sich – am 23. Februar 2025. Dann wird neu gewählt. Ein halbes Jahr vor dem regulären Termin.
Quelle: Daniela Vates in RN (DZ) vom 16. Dezember 2024