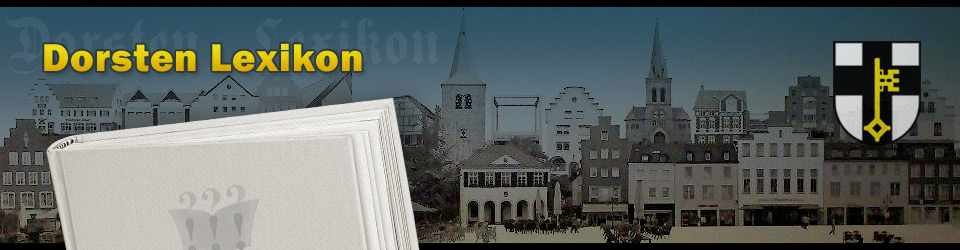Kinder im Kindergartenalter töteten 1988 Spielkameraden
„Denn sie wissen nicht, was sie tun“ – Die vier Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren wussten offenbar überhaupt nicht, was sie taten, als sie am 7. April 1988 an einem einsamen Tümpel in Barkenberg den vierjährigen André mit Steinen bewarfen. Der Junge starb. Am andern Tag fragten zwei der beteiligten Kinder im Kindergarten, wo den ihr Spielkamerad André sei. Sie scheinen die Ausmaße ihres tödlichen Tuns am Vortag nicht begriffen zu haben. Und der Siebenjährige fragte seine Eltern immer wieder, wo denn der André hingekommen sei – ob er nie wieder mit ihm spielen könne. Eltern, Jugendamt und Öffentlichkeit waren entsetzt über dieses unfassbare Geschehen in Barkenberg. Wie nur hätten die Kinder diese psychische Hemmschwelle überwinden und ihre Malträtierungen weiter fortführen können, obwohl André bereit geblutet, geweint und geschrien haben musste?
Schwierige Familiensituationen
Der siebenjährige und Steine werfende Junge war von seinem bereits mehrere Jahre lang arbeitslosen Vater mit kommandierenden Anweisungen erzogen worden, die befolgt werden mussten. Ansonsten herrschte in der Familie Sprachlosigkeit. Zwei andere am Unglück beteiligte Kinder kamen waren Brüder. Über die dritte Familie war lediglich zu erfahren, dass sie, wie die anderen beiden Familien auch, sozial schwach war. Tagelang wurde der Siebenjährige von der Schule ausgeschlossen, weil die Schulkameraden ihn als „Mörder“ bezeichnet hatten, und alle Seiten mit der Situation offenbar nicht umgehen konnten. Erst nach der Beerdigung von André, der einer Barkenberger Spielgruppe angehörte, durfte der Siebenjährige wieder zur Schule gehen.
Das Jugendamt bemühte Experten, um zu erfahren, wie mit den Kindern in diesem schrecklichen Fall zu verfahren sei. Diplom-Psychologe Hans-Udo Schneider meinte, selbst wenn die Familiensituationen schwierig seien, diene es weder den Kindern noch den Eltern mit der Wegnahme der Kinder aus den Familien. „Isolierende Maßnahmen sind Gift für die Kinder.“ Sie verstärkten Aussonderungsprozesse, denen die Kinder vermutlich später ohnehin ausgesetzt seien, und machten eine Verarbeitung des grausamen Ereignisses unmöglich. Schule und Kindergarten müssten sich aber auf ängstliche oder sogar hysterische Reaktionen der anderen Eltern einstellen, wenn zum Beispiel eins der Kinder irgendwann einmal aus der Rolle fallen würde. Hilfe müsse so ausfallen, äußerte sich damals das Jugendamt, dass „bei den Kindern und Eltern keine verdrängten Rückstände“ blieben. Eine Therapie sollte länger angelegt sein. Auch sollten Nichtbetroffene das „unfassbare Ereignis nicht vereinfachend auf das jeweilige Familienmilieu schieben“. Dazu sei die gesamte Problematik zu vielschichtig. Hans-Udo Schneider: „Meiner Meinung nach geht das Ereignis jeden etwas an. Schließlich spiegelt sich in den Kindern ein Teil unserer Gesellschaft wider.“
Mit Problemen beladenes Elternhaus
Aggressionen, die überall in der Gesellschaft (auf Autobahnen, bei Kriegen, Entführungen von Flugzeugen, am Arbeitsplatz) spürbar seien, seien ein zum Scheitern verurteilter Versuch, miese Lebensumstände zu beseitigen. In diesem Barkenberger Fall lasteten die gesellschaftlichen Gegebenheiten, beispielsweise Langzeitarbeitslosigkeit, wie ein Gefängnis auf den drei Familien. Oftmals werte der Einzelne sein Schicksal als individuelles Versagen, wodurch wiederum Aggressionen frei würden, die dann an Schwächeren, in dem Fall den Kindern, entladen würden. In einem derart beengten familiären Gefüge, in denen die Eltern alle Kraft zur Lösung der eigenen Probleme benötigten, sei kaum Platz für Wärme und Vertrauen. Die Kinder würden keine Partnerschaftlichkeit kennen und haben kein Verhältnis zum Schmerz. Schmerz sei für sie normal und nicht bedrohlich, weil sie ihn täglich im Problem beladenen Elternhaus miterlebten. „Vielleicht wird so erklärbar, wieso die Kinder ihre Aggressionen auch wieder an einem viel Schwächeren ausließen, dem vierjährigen André, und selbst den Schmerz des anderen nicht als solchen erkannten.“
Quelle:
Verkürzt entnommen H. Sieg „Denn die Kinder wissen nicht, was sie tun…“ in Recklinghäuser Zeitung vom 16./17. April 1988.