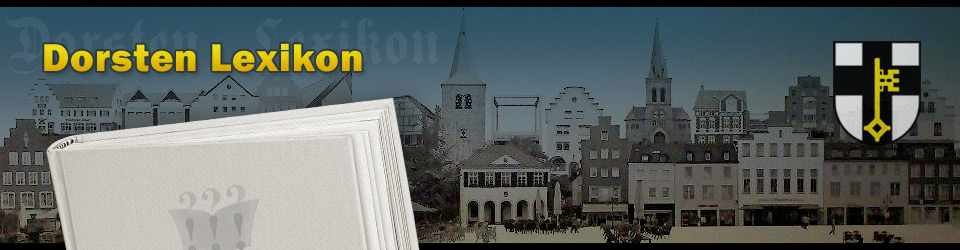Können Ausländer mit zwei Pässen deutsche Staatsangehörige werden?
Ginge es nach der CDU, können Menschen mit zwei Pässen künftig die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, wenn sie sich ein Fehlverhalten leisten. Drei Doppelstaatler erzählten den Ruhr Nachrichten (Dorstener Zeitung), wie eine solche Diskussion auf sie wirkt – und wovor sie Angst haben. Veröffentlicht am 16. März 2024:
Genau 24 Jahre, zehn Monate, eine Woche, zwei Tage, nachdem er offiziell Deutscher wurde, sei ihm deutlich wie nie zuvor gezeigt worden, dass er niemals richtig dazugehören wird. „Was und wie Merz kommuniziert hat, hat etwas in mir zerstört, was man nicht mehr aufbauen kann“, sagt Dejan Mihajlović. Seine Stimme klingt resigniert, ja teilweise sogar verzweifelt. Er hatte doch immer noch die Hoffnung, irgendwann nicht mehr erklärt zu bekommen, warum er trotz deutschem Pass kein Teil dieses Landes ist. „Okay, ich habe es jetzt auch verstanden, ich werde in euren Augen nie Deutscher sein.“ Vor der Wahl brachte die CDU einen Antrag im Bundestag ein: Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft soll bei „schweren Straftaten“ oder „gegen unsere freiheitlich demokratische Grundordnung gerichteten Handlungen“ die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt werden können. Eine „schwere Straftat“ ist demnach bereits, sich antisemitisch zu äußern. Im Sondierungspapier von CDU und SPD ist festgehalten, dass der Vorschlag geprüft werden soll.
Kein Gefühl der Sicherheit
Der Antrag, für den die CDU Stimmen der AfD in Kauf genommen hat, war nur eine Empfehlung an den Bundeskanzler. Seitdem hat das Lebensgefühl von Mihajlović gelitten. Baut der Jürgen von nebenan Mist, greift das Strafrecht. Baut Dejan Mihajlović Mist, ist er kein Deutscher mehr. „Ich fühle mich nicht mehr so sicher wie zuvor in Deutschland. Allein dadurch, dass diese Idee kommuniziert wurde, wird ein Klima der Radikalisierung begünstigt“, sagt der 48-Jährige. Mihajlović ist im ehemaligen Jugoslawien geboren. Seine Eltern kamen als Gastarbeiter nach Deutschland, durch sie hat er die serbische Staatsbürgerschaft. Im Alter von vier, fünf Jahren kam er nach Deutschland, wuchs hier auf, studierte. Am 22. März 2000 wurde er Deutscher. „Erst dachte ich, das sei nur ein Papier, aber es hat etwas mit mir gemacht. Ich hatte das Gefühl, dazuzugehören“, sagt er. „Mir war schon klar, dass die Probleme nicht weggehen, dass der Rassismus nicht weggeht, aber ich hatte eine Stimme.“ Und nun das. „Jemand aus der stärksten Partei Deutschlands, der Kanzlerkandidat, sagt Dinge, die mich ausgrenzen und abwerten zu einem Deutschen zweiter Klasse.“ Aus der Geschichte weiß man, so der 48-Jährige, wie es laufen kann. „Willkür ist ein Hebel. Wenn man es möchte und es darauf anlegt, wird man etwas finden.“
2023 wurden in Deutschland 200.095 Ausländer eingebürgert
Im Jahr 2023 wurden laut Statistischem Bundesamt 200.095 Menschen aus 157 Staaten in Deutschland eingebürgert. 38 Prozent kommen aus Syrien. Auf den Plätzen danach: Türkei, Irak, Rumänien, Afghanistan. Wer eingebürgert werden will, muss mindestens seit fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland leben, eine bestätigte Staatsbürgerschaft haben, Deutsch auf B1-Niveau sprechen, den Lebensunterhalt eigenständig aufbringen können, einen Einbürgerungstest bestehen und nicht vorbestraft sein. Farnaz Nasiriamini ist im Iran geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Deutschland ist Heimat. Ihr war es deshalb wichtig, sich hier auf die Grundrechte berufen zu können. Demonstrationsrecht, Berufsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, all diese Rechte, die für Menschen aus Drittstaaten eingeschränkt sind. Am 16. März 2016 war es so weit. Die einzige Heimat, die sie je kannte, wurde offiziell ihre Heimat.
Heimat – Basis für ein Ankommen und existentielles Zuhause
Jetzt aber ist es, als würden ganz viele Menschen, inklusive jener, die Macht haben, daran zweifeln, dass ihr Zuhause auch wirklich ihr Zuhause ist. Heimat. Etwas Existenzielles. Die Basis für gesellschaftliche Teilhabe, für ein Ankommen, fürs Wohlfühlen. „Ich finde es schlimm, wenn mir suggeriert wird, dass Deutschland nicht meine Heimat sein kann.“ Eine Einbürgerung in Deutschland bedeutet nicht automatisch, zwei Pässe zu bekommen. 80,9 Prozent erhielten 2023 die doppelte Staatsbürgerschaft. Das war beispielsweise bei Menschen aus Syrien, den USA, Argentinien und Tunesien so. Eingebürgerte mit Wurzeln in der Türkei oder Subsahara-Afrika mussten ihre bisherige Staatsbürgerschaft in mehr als 90 Prozent der Fälle abgeben. Die alte behalten darf man beispielsweise, wenn es nicht zumutbar ist, diese aufzugeben, wenn Repressalien drohen oder man als anerkannter Geflüchteter ins Land kam.
Sorge vor Missbrauch rechtlicher Regelungen
Farnaz Nasiriamini hatte keine Wahl. Der Iran duldet nicht, dass die Staatsangehörigkeit abgelegt wird. Das Land, in dem sie geboren wurde, bleibt Teil ihrer Identität, sagt sie, aber einen Bezug hat sie dahin nicht mehr. „Ich mache mir keine Sorgen, dass mir die Staatsangehörigkeit entzogen wird, dafür weiß ich um die rechtlichen Hürden. Aber ich mache mir Sorgen, weil ich in dieser Gesellschaft lebe, in der Menschen diese Idee haben und gut finden“, sagt sie. Sie fürchtet, ebenso wie Mihajlović, dass rechtliche Regelungen missbraucht und neu ausgelegt werden könnten.
Nasiriamini ist so etwas wie eine Vorzeigedeutsche
Sie engagierte sich schon früh neben der Schule, machte Abitur, studierte politische Soziologie und Jura. Sie ist im Bundesvorstand des Deutschen Juristinnenbundes. „Ich musste immer besonders gut sein, um in dieser Gesellschaft bestehen zu können“, sagt sie. Jetzt hat sie als Juristin das Handwerkszeug, sich und andere zu schützen, wenn man ihr mal wieder erzählt, dass etwas nicht geht. Trotzdem wird sie immer wieder auf ihren Migrationshintergrund reduziert. „Ich will nicht die gut integrierte Ausländerin sein“, sagt sie, „ich bin Deutsche und will, dass die Maßstäbe des Deutschen an mir angelegt werden.“ Ihr eigener Weg sei eine Ausnahme. „Es werden einem so viele Steine in den Weg gelegt und es hat so viel mit Glück zu tun, überhaupt einen Schulabschluss zu schaffen. Diese Hürden werden unsichtbar gemacht, wenn man mich zur Messlatte macht.“
„Leute diskutieren über ein Thema und ich … über mein Leben“
Nasiriamini und auch Mihajlović ärgert, dass die Migrationsdebatte mit einer Diskussion um die Nützlichkeit einhergeht. Mihajlović kennt es nur zu gut: In Gesprächen bekomme er zu hören, er sei doch gar nicht gemeint, er sei doch der gute Ausländer. „Die Leute diskutieren über ein Thema und ich diskutiere über mein Leben.“ Wie viele Menschen mit der doppelten Staatsangehörigkeit es hierzulande gibt, ist nicht bekannt. Im Mikrozensus 2023 gaben 2,9 Millionen an, zwei Staatsbürgerschaften zu haben, wobei 70 Prozent davon eine weitere europäische Staatsbürgerschaft besaßen. Die Zahlen unterscheiden sich je nach Erhebung stark. Im Mikrozensus 2022 gaben 2,7 Millionen an, die deutsche und eine weitere Staatsbürgerschaft zu haben, im umfangreicheren Zensus des gleichen Jahres waren es 5,8 Millionen. Wenn derzeit über Migration debattiert wird, wird über Menschen wie Khalid Waleed Khalid geredet. Er kam 2015 aus dem Irak nach Deutschland, illegal. Die Situation in seinem Heimatland wurde immer unsicherer, die dem Studenten so wichtige Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Sechs Monate Sammelunterkunft, eine kleine Wohnung in Hannover. Er wollte mit den Menschen in Kontakt kommen, habe aber gemerkt, dass die Deutschen nicht so gerne Englisch sprächen. Also lernte er Deutsch. Machte eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Die Einbürgerung sei ihm wichtig gewesen, so der 31-Jährige. Weil er ein politischer Mensch ist. Und weil er die gleichen Rechte wollte. Im Oktober 2024 wurde Khalid Waleed Khalid Deutscher.
„Stimmung gegen Migrantinnen und Migranten aggressiver geworden!“
Er fürchtet nicht, dass man ihm die Staatsbürgerschaft wieder entzieht. Aber generell, sagt er, stehe er noch unentschlossen zum Vorschlag der CDU. „Ich kann das nicht befürworten und nicht schlimm finden“, sagt er. „Es geht um straffällig gewordene Menschen und welche, die sich nicht richtig mit dem Land identifizieren.“ Er findet: „Eine Einbürgerung darf kein Freifahrtschein sein, sich alles zu erlauben.“
Doch insgesamt ist die Stimmung gegen Migrantinnen und Migranten aggressiver geworden, sagt Khalid. Auch nach der Einbürgerung hat er nicht aufgehört, mit seiner irakischen Frau darüber zu sprechen, dass sie Deutschland vielleicht irgendwann verlassen müssen. „Ich sehe, dass die politische Agenda immer radikaler wird. Natürlich möchte ich hier bleiben, ich habe mir etwas aufgebaut, meine prägendsten Jahre hier verbracht.“
Auch Farnaz Nasiriamini denkt immer häufiger darüber nach, ob hierzulande Platz für sie ist. In ihrem Umfeld würden alle mit Migrationsgeschichte nach Zielen zum Auswandern schauen. „Wir diskutieren immer, wen wir hier haben wollen. Aber vielleicht sollten wir mal die Frage stellen, wer überhaupt noch hier leben will, wenn wir menschenverachtende Narrative zulassen und diese gesellschaftlich normalisiert werden.“ Bedenklich sei es, sagt die Juristin, dass verfassungsrechtliche Regelungen, die immer Konsens gewesen seien, plötzlich infrage gestellt werden. „Dinge, die früher nicht ausgesprochen wurden, werden jetzt selbst von Politikern im Bundestag wie selbstverständlich rausgehauen. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung.“
Heimat, die es zu schützen gilt
Dejan Mihajlović hat sich nach seiner Einbürgerung stark ins Zeug gelegt. Er ist Lehrer, engagiert sich in der Demokratiearbeit, hat im vergangenen Jahr mit 30.000 Teilnehmenden die größte Demonstration in Freiburg in der Nachkriegsgeschichte organisiert, die eine Einzelperson angemeldet hat. Als er darüber sprach, kamen ihm die Tränen. Mihajlović kennt zwei Welten. Er hat als Kind und als Erwachsener in Serbien und in Deutschland gewohnt. „Schon als kleines Kind war mir klar, dass ich hier viele Freiheiten habe, die ich in Jugoslawien nicht hatte. Genau deshalb möchte ich diese Werte verteidigen.“ Dennoch könne er seinen Kindern die Angst nicht nehmen, wenn sie fragen, ob sie aus Deutschland weggehen müssten. „Es ist schwer, ihnen zu sagen, dass das so schnell nicht geht, denn ehrlicherweise bin ich mir nicht mehr sicher“, sagt er leise. „Es passieren gerade Dinge, von denen ich dachte, dass sie nie passieren würden.“ – Was und wie Merz kommuniziert hat, hat etwas in mir zerstört, was man nicht mehr aufbauen kann.
Quelle: Ruhr Nachrichten (Dorstener Zeitung) vom 16. März 2025
Kein passender Begriff gefunden.