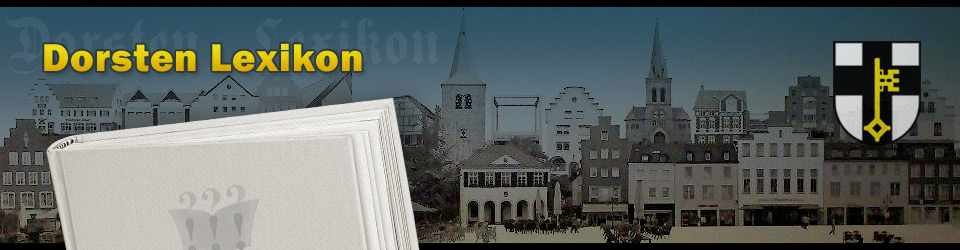Es geht dabei um Medikamente, Diagnosen, Röntgenbilder oder Arztbriefe
Anfang des Jahres 2025 war die elektronische Patientenakte verbindlich eingeführt worden. Sie konnte zwar schon vorher beantragt werden. Das hat aber kaum jemand genutzt. Die Zeiten sind vorbei. Durch die flächendeckende Einführung der elektronischen Patientenakten (ePA) können Behandler nun Informationen dort ablegen. Insbesondere geht es dabei um Medikamente, Diagnosen, Röntgenbilder oder Arztbriefe. Die Krankenkassen sollen Abrechnungen einpflegen, sodass zu erkennen ist, wann welcher Arzt warum aufgesucht worden ist.
Was müssen Versicherte tun? Im Grunde nichts. Doch wenn Versicherte nicht möchten, dass alle Behandler (und die angestellten Helfer und Helferinnen) die meisten Inhalte sehen können, müssen sie sich regen. Dabei sollte nicht einfach komplett widersprochen werden. Denn die ePA bietet auch Chancen: Ärzte können sich zum Beispiel ein besseres Bild machen, wenn sie Vorbefunde kennen und wissen, welche Medikamente eingenommen werden. Auch werden Unterlagen wie das Zahnbonusheft dort digital geführt. Die Versicherten können die ePA über eine App so gestalten, wie es ihnen „passt“.
Wer soll was einsehen dürfen? Die ePA ist „ab Werk“ so programmiert, dass viele Personen aus dem Gesundheitssystem die meisten Inhalte aus der Versichertenkarte auslesen können. Das gilt für die Angestellte einer Arztpraxis oder den Apotheker. Pflegedienste oder Physiotherapie-Praxen können später dazukommen. Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Patientenverbände wie die Aids-Hilfe sehen die automatische Datenfreigabe kritisch. Viele Versicherte sind sich dieser sehr weitreichenden ePA-Voreinstellung nicht bewusst. Wichtig: Die Krankenkasse darf die elektronische Akte nicht lesen. Nur deren Ombudsstelle hat Zugriff darauf – vorausgesetzt, der oder die Versicherte hat das erlaubt.
Wie kann die Einsichtnahme geregelt werden? Zunächst kann es direkt bei der Behandlung gesagt werden, wenn ein Befund nicht in die ePA eingetragen werden soll. In bestimmten Fällen, etwa bei sexuell übertragbaren Krankheiten, muss der Behandler von sich aus darauf hinweisen, dass widersprochen werden kann. Befunde, die bereist eingetragen sind, können verborgen werden. Das geht über die App oder über die Ombudsstelle der Kasse.
Wie wird die App freigeschaltet? Benutzer müssen sich in der App registrieren und persönlich identifizieren. Das ist etwas aufwendig, muss aber nur einmal gemacht werden. Die Verfahren zur Identifizierung in der App unterscheiden sich je nach Krankenkasse. Entweder geht das per neuerem Personalausweis, der über die Handykamera gelesen werden kann, oder über die Krankenkassenkarte mit PIN. Die Krankenkassen helfen, wenn Probleme auftreten.
Was sind weitere Vorteile der App? Die App hat etliche Funktionen: Arztbriefe können gelesen, an Vorsorgetermine und Impfungen kann erinnert oder es kann einfach mal nachgesehen werden, was der Doc abrechnet. Die Sichtbarkeit der Inhalte kann verborgen werden. Alle Daten (oder nur Teile) lassen sich verbergen. Das gilt für alle oder nur für bestimmte Behandler. Auch kann ausgesucht werden, ob das dauerhaft oder nur zeitweise gelten soll.
Quelle: RN (SZ) vom 19. Februar 2025
Kein passender Begriff gefunden.