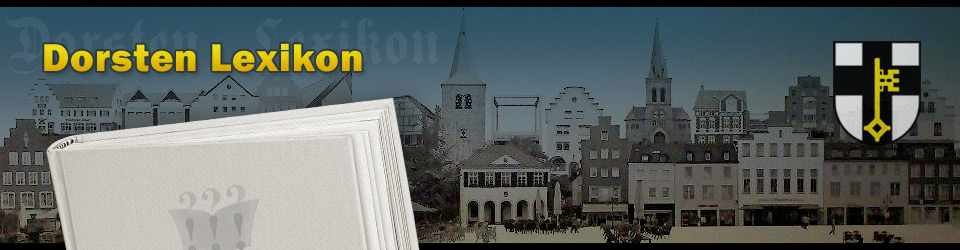April, April, der weiß nicht, was er will“ – die „Eisheiligen“ im Mai allerdings
Landwirtschaft, Gartenfreunde und nicht zuletzt die Binnenschifffahrt sorgen sich wegen des trockenen Frühlingsbeginns. Wie schön wäre es, mit der Hilfe von Bauernregeln etwas in die Zukunft zu blicken. Der Deutsche Wetterdienst hat einige unter die Lupe genommen und erklärt, welche zutreffen – und welche wir eher vergessen können. April, April, der weiß nicht, was er will“ ist die wohl bekannteste Bauernregel für das Wetter im Frühling. Und sie stimmt: morgens Hagel, mittags Sonne, und am Nachmittag wieder Sturm und Regen – so kann ein typischer Apriltag aussehen. Zum Frühlingsbeginn ist das Wetter oft instabil und kann sich von Tag zu Tag oder sogar innerhalb eines Tages stark verändern. „Das ist einfach eine langjährige Beobachtung, die die Menschen gemacht haben“, sagt Lisa Brunnbauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Meteorologin kann auch erklären, wie wechselhaftes Aprilwetter zustande kommt: „In dieser Zeit ändert sich zum einen der Sonnenstand. Die Rotationsachse der Erde verändert sich und die Nordhalbkugel neigt sich wieder mehr zur Sonne. Es kommt also zu einer stärkeren Sonneneinstrahlung, wodurch sich der Boden erwärmt und warme Luft aufsteigt. Gleichzeitig gibt es in höheren Schichten zu dieser Zeit noch kältere Luft, oft aus Nordosten, die absinkt.“ Durch dieses Wechselspiel könne es zu den typischen, plötzlichen Umbrüchen kommen. Ist die aufsteigende warme Luft feucht, drohen kräftige Schauer mit Hagel.
Die katholischen Eisheiligen kommen erst im Mai
Auch von den „Eisheiligen“ hat wohl jeder schon einmal gehört. Gemeint sind damit die Tage vom 11. bis zum 15. Mai, die den katholischen Heiligen Mamertus (11. Mai), Pankratius (12. Mai), Servatius (13. Mai), Bonifatius (14. Mai) und Sophie (15. Mai) zugeordnet sind. Als die Eisheiligen gelten sie deshalb, weil in diesen Tagen oft noch unerwartete Frosteinbrüche drohen, die Pflanzen und Ernte schaden können. Davor warnt eine Vielzahl von Bauernregeln – wie zum Beispiel: „Pflanze nie vor der kalten Sophie“, „Wenn’s an Pankratius friert, so wird im Garten viel ruiniert“, oder „Servaz muss vorüber sein, willst vor Nachtfrost sicher sein.“ Dass es genau an diesen Tagen friert, stimme natürlich nicht immer, sagt die Meteorologin Lisa Brunnbauer: „Richtig ist aber, dass es im Monat Mai immer noch einmal einen Kälteeinbruch geben kann.“ Ohnehin habe es seit dem Mittelalter eine Kalenderreform gegeben: Die Tage, die früher als Eisheilige bezeichnet wurden, fielen heute eher in die Zeit gegen Ende Mai. Die Umstellung des Kalenders macht auch viele andere, sehr alte Bauernregeln zumindest ungenau. Auch wenn sie denn einmal gestimmt haben sollten, müssten die Datumsangaben neu berechnet werden.
„Schweißheilige“ statt Eisheilige
In einem Beitrag auf seiner Internetseite vermeldet der DWD jedenfalls, dass die Eisheiligen heutzutage immer öfter ausbleiben. Oder dass sie manchmal schon Anfang oder erst Ende Mai auftreten. Und dass sommerliche Temperaturen immer öfter nicht erst nach den Eisheiligen, sondern schon im April zu beobachten sind. Gelegentlich seien die Eisheiligen in den vergangenen Jahren bei Tageshöchstwerten von über 25 Grad Celsius sogar zu „Schweißheiligen“ geworden. Ein möglicher Grund sei der Klimawandel: „Mit der stetigen Erwärmung der globalen Atmosphäre fallen auch Kaltlufteinbrüche im Mai immer weniger frostig aus“, schreibt der DWD. Kommt es im Juni zu einer Kälteperiode mit Regenfällen, dann ist meist von der Schafskälte die Rede. Denn in diese Zeit fällt üblicherweise die Schur der Schafe. Wurden die Schafe geschoren, bevor es noch einmal kalt wird, wird es für sie allerdings ungemütlich. Bauernregeln für die Schafskälte beziehen sich häufig auf den 11. Juni, den St.-Barnabas-Tag, der mitten in diese Zeit fällt. Eine lautet: „Barnabas macht Bäume und Dächer nass.“
Durch Wetterdaten bestätigt
Die Schafskälte ist durch meteorologische Daten bestätigt: „Oft gibt es zwischen dem 4. und 20. Juni in Mitteleuropa einen Kälteeinbruch“, schreibt der DWD. Die Schafskälte entstehe durch die unterschiedlich schnelle Erwärmung von Land und Meer. „Die Landmassen sind im Juni bereits stark erwärmt, das Meer allerdings noch relativ kalt. Dadurch entstehen Tiefdruckgebiete über der See, die dann kalte Luft polaren Ursprungs nach Europa bringen“, so der Deutsche Wetterdienst. Statistisch betrachtet sei die Schafskälte in den vergangenen 100 Jahren in etwa 61 Prozent der Fälle eingetreten.“ Betrachtet man nur den Zeitraum vom 10. bis 12. Juni, so liege die Wahrscheinlichkeit für eine unterdurchschnittliche Lufttemperatur bei etwa 80 Prozent, für eine überdurchschnittliche Niederschlagsaktivität bei rund 55 Prozent.
Wie das Wetter ist, so hält es sich meist den Sommer lang
An dieser Bauernregel ist laut der Plattform Wetter.com durchaus etwas Wahres. „Mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 70 Prozent folgt auf einen warmen Frühlingsanfang auch ein warmer Sommer“, heißt es dort. Allerdings ist es auch hierbei gut möglich, dass der Klimawandel das Ganze verfälscht. So werden seit einigen Jahren immer öfter überdurchschnittlich warme Frühlingstemperaturen beobachtet, sowie überdurchschnittlich warme Sommer. Und der Sommer folgt nun mal auf den Frühling.
Ausnahme Siebenschläfertag
Der Deutsche Wetterdienst kann die Regel „warmer Frühling gleich warmer Sommer“ jedenfalls nicht bestätigen. „Fast alle Bauernregeln, die solche Vorhersagen machen, sind Unsinn“, sagt Brunnbauer. Dass das Wetter an bestimmten Tagen, die deshalb auch „Lostage“ genannt werden, die Witterung der nächsten Wochen oder gar einer ganzen Jahreszeit anzeigen soll, sei meist nicht richtig: „Wir haben das alles einmal durchgerechnet, und in den meisten Fällen keine statistischen Zusammenhänge gefunden.“ Eine Ausnahme sei der Siebenschläfertag, der aber auf den 27. Juni fällt und damit bereits im Sommer liegt. „Ist der Siebenschläfer nass, regnet’s ohne Unterlass“, besagt eine Bauernregel. Und das scheint häufig zu stimmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Witterung, die von Ende Juni bis Anfang Juli herrscht, auch in den darauffolgenden Wochen bestehen bleibt, liegt laut DWD beispielsweise in Süddeutschland bei bis zu 70 Prozent.
Siehe auch: Wetter (Essay)
Siehe auch: Wetterjahr 2011
Siehe auch: Wetter – Landwirtschaftsjahr 2024
Siehe auch: Stürme/Orkane/Wetter
Siehe auch: Unwetter Ela 2024
Siehe auch: Stürme ab Februar 2022
Siehe auch: Sturmtief Sabine 2020
Siehe auch: Sturmtief Zoltan 2023
Siehe auch: Sturmtief Nasim 2022
Siehe auch: Sturmtief Friederike 2018
Siehe auch: Sturmtief Zeljko 2015
Siehe auch: Sturmtief Kyrill 2007 u. a.
Siehe auch: Sturmstoß 2019 – kurz und heftig
Quelle: RN-Magazin (DZ) 31. März 2025
Kein passender Begriff gefunden.