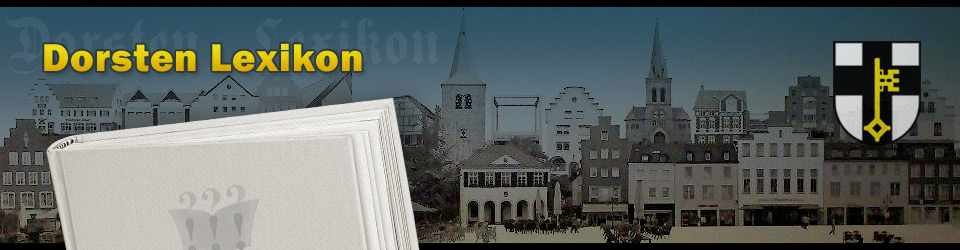Es gibt viele Gründe, die Heimat zu verlassen, um Zufluchtsorte zu finden
Die Klimakrise macht krank, zerstört Ökosysteme und Lebensgrundlagen. Weltweit sind deshalb Millionen Menschen auf der Flucht. Doch je mehr der Notstand voranschreitet, desto schwieriger wird es, sichere Zufluchtsorte zu finden. – Sie musste einfach fliehen. Zu lange hatte es in ihrer Heimat im Süden Somalias nicht mehr geregnet. Ihre Ernte war zerstört, ihr Viehbestand tot. „Es gab nichts mehr zu essen für meine Kinder. Sie weinten und weinten und weinten“, erinnert sich Shamsa Amin Ali. Die 38-Jährige sah nur noch einen Ausweg: Mit ihrer Familie, darunter ihre 82-jährige Mutter, floh sie vor drei Jahren ins benachbarte Kenia. Dort kamen sie im Dadaab-Flüchtlingslager unter. Eigentlich sollte das Flüchtlingslager nur eine vorübergehende Notunterkunft sein. Doch Ali sieht nach wie vor keine Chance, bald in ihre Heimat zurückkehren zu können, wie sie im vergangenen November in einem Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR erzählt: „Die Dürre ist immer noch da. Meine Farm, meine Tiere und sogar mein Haus sind zerstört, es gibt also nichts, wohin ich zurückkehren könnte. Ich kann nicht dorthin zurückkehren, wo es keine Schulen für meine Kinder gibt.“
Ali gehört zu den Millionen Menschen, die vor der Klimakrise fliehen
Allein im Jahr 2023 waren es nach Angaben des UNHCR rund 26,4 Millionen Menschen, die ihre Heimat aufgrund von Katastrophen und klimabedingten Ereignissen wie Dauerregen, lang anhaltenden Dürren, Hitzewellen und Stürmen kurz- oder langfristig verlassen mussten. „Der Klimawandel wirkt nie allein“, sagt Jana Birner, Klimaexpertin beim UNHCR, „sondern er kann andere Ursachen für Vertreibung noch verstärken.“ Hauptursachen für Vertreibungen seien Gewalt und Konflikte. Indem der Klimawandel zum Beispiel Dürren verstärkt, sorgt er in Afrika für eine zunehmende Trinkwasserknappheit. Das kann neue Konflikte hervorrufen oder alte verschlimmern und soziale Ungleichheiten in der Bevölkerung verschärfen.
Vor allem in Afrika und Asien fliehen viele Menschen vor den Auswirkungen der Klimakrise. Länder wie der Sudan, Syrien, Haiti, die Demokratische Republik Kongo, der Libanon, Myanmar, Äthiopien, der Jemen und Somalia sind anfällig für klimawandelbedingte Gefahren. Ihnen fehlen etwa die finanziellen Mittel, um sich an den Klimawandel anzupassen.
Die meisten Klimaflüchtlinge fliehen innerhalb ihres Heimatlandes. „Die Leute versuchen, so nah wie möglich an ihrem Wohnort zu bleiben“, erklärt Birner. „Die Menschen wollen nicht unbedingt ihre Länder verlassen. Sie wollen ihre Familien, ihr soziales Sicherheitsnetz nicht zurücklassen.“ Dem UNHCR zufolge sind in den vergangenen zehn Jahren 220 Millionen Menschen innerhalb ihres Landes vor klimawandelbedingten Katastrophen geflohen. Das sind etwa 60.000 Vertreibungen pro Tag. Im Jahr 2023 waren es vor allem Überflutungen, die für Binnenvertreibungen gesorgt haben – gefolgt von Stürmen, Erdbeben und Tsunamis.
Immenser Kraftakt
„Vertreibung bringt unbeschreibliche Verluste und Leiden mit sich, die wirklich herzzerreißend sind, und verstärkt die Anfälligkeit“, weiß Birner. „Sie schafft neue Risiken, insbesondere für Kinder und vulnerable Menschen wie Menschen mit Behinderungen.“
Zu fliehen ist für die Menschen ein immenser Kraftakt – sowohl in psychischer als auch körperlicher Hinsicht: Nicht nur müssen sie ihr Zuhause verlassen, in dem sie sich sicher fühlen, sie lassen auch Freunde, vielleicht sogar Familie zurück; ziehen zu Fuß tagelang umher, um dann in unzureichenden Zelten und Notunterkünften unterzukommen, die kaum Schutz vor den Klimagefahren bieten. Das UNHCR erwartet, dass bis 2050 die meisten Flüchtlingssiedlungen und -lager doppelt so viele Tage gefährlicher Hitze erleben werden – und das oft ohne ausreichende Klimatisierung. Zu hohe Temperaturen können gerade für vulnerable Menschen wie Ältere tödlich sein. Deshalb arbeitet das Flüchtlingshilfswerk an klimaresistenten Unterkünften mit lokalen Materialien wie Holz, Bambus oder Sand. Schon jetzt ist jedes Land in irgendeiner Weise vom Klimawandel betroffen – die einen stärker, die anderen schwächer. Der Klimakrise ganz zu entkommen, ist nicht mehr möglich. Und irgendwann wird es wohl auch nicht mehr ausreichen, nur innerhalb des Heimatlandes zu fliehen. Fachleute warnen bereits vor der größten Flüchtlingskrise aller Zeiten. Doch solche Aussagen und Prognosen bleiben spekulativ. Es gibt immer wieder Studien, zum Beispiel die von Migrationswissenschaftler Frédéric Docquier von 2019, die zwar eine zunehmende Migration voraussagen, aber nicht in dem befürchteten Ausmaß. Jana Birner geht davon aus, dass die Zahl der Binnenvertriebenen steigen wird – allein aus dem Grund, weil es immer häufiger zu Kriegen kommt. „Ich glaube aber nicht, dass es zum Beispiel um Massenbewegungen nach Europa gehen wird“, sagt sie.
Klimaflüchtlinge nicht von der Genfer Konvention geschützt
Würden immer mehr Klimaflüchtlinge ihre Heimat verlassen und Ländergrenzen überschreiten, gäbe es auch ein Problem: eine Gesetzeslücke. Denn Menschen, die vor Klimaveränderungen und Umweltkatastrophen fliehen, fallen grundsätzlich nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention. Das heißt, sie haben keinen rechtlichen Anspruch darauf, in einem neuen Land aufgenommen zu werden und dort Schutz zu erhalten. „In der Genfer Flüchtlingskonvention werden Flüchtlinge ausdrücklich definiert als Personen, die sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung zum Beispiel wegen ihrer Religion oder politischen Überzeugung außerhalb ihres Landes befinden und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen können oder wollen – wegen dieser Befürchtungen“, erklärt Juristin Laura Kraft, die am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg forscht. „Das heißt, die Genfer Flüchtlingskonvention schützt Personen vor diskriminierender Verfolgung, aber eben nicht vor Klimaveränderungen oder Umweltkatastrophen.“ Kraft warnt davor, die Konvention um den Fluchtgrund „klimawandelinduzierte Vertreibung“ zu ergänzen. „Das könnte dazu führen, dass bestehende Schutzstandards für Flüchtlinge im Rechtssinne neu diskutiert oder im schlimmsten Fall abgebaut werden könnten“, sagt sie. Den Schutzanspruch für Klimaflüchtlinge per Zusatzprotokoll festzuschreiben, hätte wiederum den Nachteil, dass das Protokoll eine freiwillige Selbstverpflichtung unterzeichnender Länder wäre. Das heißt, da „käme es maßgeblich auf den Willen der verhandelnden Staaten an“.
Am Ende scheint es wohl nur eine Lösung zu geben: „Es wäre wünschenswert, wenn sich die Staaten darauf einigen könnten, einen neuen Vertrag für vom Klimawandel vertriebene Menschen zu entwerfen“, sagt Kraft. „Angesichts des aktuellen politischen Klimas rund um Flucht und Migration erscheint mir das jedoch unrealistisch. Ein solcher Vertrag müsste zudem komplexe, rechtliche Fragen beantworten – nämlich, welcher Personenkreis genau geschützt wäre und welche Rechte diese Personen hätten.“
Souveränität der Staaten
Die Juristin sieht zudem eine Chance in bilateralen Abkommen, „die schneller und einfacher umgesetzt werden können als auf regionaler und internationaler Ebene“. Ein solches Abkommen haben zum Beispiel Australien und der pazifische Inselstaat Tuvalu geschlossen. Damit erklärt sich Australien bereit, Klimaflüchtlinge aus Tuvalu aufzunehmen und ihnen ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu gewähren. Der dem australischen Kontinent vorgelagerte Inselstaat ist durch Stürme und einen steigenden Meeresspiegel bedroht.
Industriestaaten als Hauptverursacher der Klimakrise zu verpflichten, Klimaflüchtlinge aufzunehmen, ist keine Option. Denn: „Grundsätzlich besitzen die Staaten Souveränität, sie können entscheiden, welche Personen in ihr Land einreisen dürfen“, klärt Kraft auf. „Begrenzt ist diese Souveränität durch internationale Verträge wie die Genfer Flüchtlingskonvention, die Staaten rechtlich verpflichten, entsprechende Personen aufzunehmen oder eben durch die Menschenrechte. Ansonsten kommt es auf den politischen Willen der Staaten an.“
Den Flüchtenden Schutz zu bieten, ist die letzte Option, die im Kampf gegen globale Vertreibungen bleibt. Doch es gebe auch präventive Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, sagt Birner, damit erst gar nicht so viele Menschen ihr Zuhause verlassen müssen. Aus ihrer Sicht braucht es zum Beispiel mehr Investitionen in fragile und konfliktbetroffene Gebiete. „Wir stellen fest, dass nicht genügend finanzielle Mittel für die vertriebenen Gemeinschaften zur Verfügung gestellt werden, um ihre lokalen Lösungen wirklich zu unterstützen“, sagt sie.
Engagement junger Familien und Jugendgruppen
Unter den Vertriebenen gebe es viele „Vorreiter in Sachen Klimaschutz“, so Birner. Einer davon ist Mohammed Anower. Der 18-Jährige musste wegen anhaltender Gewalt seine Heimat Myanmar verlassen und flüchtete mit seiner Familie nach Bangladesch, in die Flüchtlingssiedlung Kutupalong. Dort engagiert er sich in einer Jugendgruppe, die Klimaaktionen durchführt. Zum Beispiel befreiten die Jugendlichen einen Bach, der an der Unterkunft von Anowers Familie vorbeiläuft, von Abfall und pflanzten Bäume und Gräser entlang des Ufers. Dadurch konnten sie verhindern, dass das Wasser bei Monsunregen über die Ufer tritt.
Wichtige Maßnahme: Die CO₂-Emissionen reduzieren
„Wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.“ Deshalb fordert Birner, dass die Stimmen und Bedürfnisse der vertriebenen Gemeinschaften mehr Gehör finden sollten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Pläne zur Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln. Die wichtigste Präventivmaßnahme, die die Staaten im Kampf gegen klimawandelbedingte Vertreibungen ergreifen können, ist aber, die CO₂-Emissionen zu reduzieren. Anower: „Es ist wichtig, dass die Flüchtlinge in Klimafragen zusammenkommen.“ Der Bericht Global Carbon Budget 2024 hatte zuletzt festgestellt, dass die Länder 2024 37,4 Milliarden Tonnen des schädlichen Klimagases emittiert haben – das sind 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Werden die Emissionen gesenkt, ließe sich verhindern, dass die Klimakrise weiter eskaliert. Und Menschen wie Shamsa Amin Ali und Mohammed Anower müssten nicht mehr fliehen, um zu überleben.
Quelle: Laura Beigel in RN (DZ) vom 10. Februar 2025