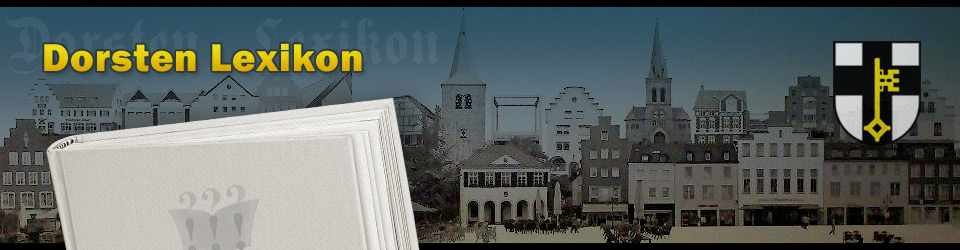Statt sie aufzuarbeiten, ist sie in Deutschland verdrängte worden
Es drohen weitere Pandemien, sagen Fachleute. Um sich auf künftige Krisen vorzubereiten, sei es wichtig, die letzte zu verstehen. Doch genau daran hakt es in Deutschland. Lohnt die Aufarbeitung noch? Am Anfang waren alle verunsichert. „Niemand wusste, was passiert und was für Auswirkungen es hat“, erinnert sich Astrid Thiele-Jèrome. Die Leiterin eines Seniorenheims in Nordrhein-Westfalen sitzt am vergangenen Freitag im Schloss Bellevue, neben ihr neun weitere Gäste. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sie eingeladen, um über die Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren Aufarbeitung zu sprechen.
Thiele-Jèrome erzählt von Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich in Corona-Zeiten mit ihren Angehörigen durch geöffnete Fenster unterhalten mussten, um Abstand zu halten. Von Mitarbeitenden, die den Seniorinnen und Senioren die Haare frisierten, als die Läden geschlossen waren. Von Bundeswehrsoldaten, die Corona-Tests durchführten, als das Pflegepersonal an anderer Stelle gebraucht wurde.
Am herausforderndsten sei es gewesen, Schutzausrüstung wie Masken zu beschaffen. „Wir sind schnell kreativ geworden“, sagt Thiele-Jèrome. Zunächst nutzten sie und ihr Team selbst gehäkelte Masken. Später, als FFP2 gefordert war, organisierte die Heimleiterin Masken aus Thailand. In Deutschland waren keine erhältlich. „Wir können eigentlich nur daraus lernen für die Zukunft“, mahnt Thiele-Jèrome.
Verdrängen oder aufarbeiten?
Aus Corona lernen – das forderte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, schon im April 2020. Also kurz nach Beginn der Corona-Pandemie. Im Nachgang müsse es „eine Zeit der Aufarbeitung“ geben. „Die daraus gezogenen Lehren werden wesentlich sein, um ähnliche Herausforderungen, wie sie in Zukunft auftreten können, wirksam anzugehen.“ Fünf Jahre später war in Deutschland genau das Gegenteil passiert: Statt die Pandemie aufzuarbeiten, ist sie verdrängt worden. Und das nicht nur, weil plötzliche andere Krisen wie der Ukraine-Krieg in den Fokus rückten. Auch aus Angst, glaubt Jutta Allmendinger. „Es sind die Ängste, dass man Gutes meint und das Gegenteil bewirkt“, sagt die Soziologin von der Freien Universität Berlin. „Die Angst, dass man für die AfD eine riesige Schneise offenlegt, wo sie noch mehr Politikversagen ausschlachten und Misstrauen in die Politik und auch in die Wissenschaft erringen kann.“ Solche Befürchtungen seien verständlich, dennoch brauche es die Aufarbeitung. „Wir müssen das machen. Auch, um jene zu hören, die Impfschäden, die Long Covid haben, denen es nicht gut geht und die immer noch Probleme haben.“
Pandemie hat die Gesellschaft nachhaltig verändert – sie wirkt nach
Denn Corona wirkt nach. Viele Verletzungen säßen tief, sagte Bundespräsident Steinmeier. Unzählige Menschen haben ihre Angehörigen verloren; Dutzende Kinder leiden unter den Folgen der Pandemie und haben psychische Erkrankungen entwickelt. Zahllose Menschen haben das Vertrauen in die Politik und Wissenschaft verloren. Corona hat die Gesellschaft nachhaltig verändert. Zeitweise hat das Virus sie sogar so stark gespalten wie lange nicht mehr. Gab es anfangs noch eine allgemeine Solidarität – Abstandsregeln wurden eingehalten, Masken getragen, um sich selbst und andere zu schützen –, wandelte sich die mit der Zeit teils in Hass und Hetze um. Die Wissenschaft wurde angezweifelt, Verschwörungstheorien (etwa zum Ursprung des Virus oder zu den Impfungen) verbreiteten sich, Corona-Fachleute wurden öffentlich beschimpft und attackiert, Maßnahmen wurden boykottiert. „Dieser Umschwung ist gut erklärbar“, sagt Allmendinger. „Weil wir schlecht kommuniziert haben.“ Eine der Lehren, die aus der Pandemie gezogen werden könnten. Zum Beispiel seien Daten wie die täglichen Infektions- und Todeszahlen, die nur vorläufig waren und von den Gesundheitsämtern unterschiedlich gemeldet wurden, nicht genügend eingeordnet worden. „Wir bekamen im Prinzip Informationen, mit denen wir wenig anfangen konnten.“
Den Menschen verständlich die Ausnahmezustände erklären
Einer, der in der Corona-Zeit immer wieder versucht hat, über das Virus und seine Folgen aufzuklären, ist Timo Ulrichs. Er ist Infektionsepidemiologe an der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Aus seiner Sicht ist das Entscheidende in der Kommunikation während solcher Ausnahmezustände, „dass man die Menschen mitnimmt, ihnen das so erklärt, dass es verständlich und nachvollziehbar ist“. Dafür sei es gut, eine absolute Instanz zu haben – so wie das Robert Koch-Institut. Stattdessen seien viele verschiedene, einander widersprechende Informationen vermittelt worden, „die nicht immer verständlich gewesen sind“. Diese Widersprüche sieht Soziologin Allmendinger als weiteren Grund für den Vertrauensverlust an. „Die Politik hat Maßnahmen getroffen, die teilweise nicht nachvollziehbar waren. Warum konnten zum Beispiel viele Eltern zur Arbeit gehen, aber die Kinder mussten zu Hause bleiben? Die Gesellschaft ist hochsensibel darin, solche Dinge sofort zu erfassen. Und ich glaube, die Politik hat einen Fehler gemacht, zu denken, dass man das nicht merkt.“ Auch die Bund-Länder-Koordination sowie die Zusammensetzung der Expertenkommissionen („Wir hatten leider viel zu spät Kommissionen, die nicht nur mit Medizinern und Virologen besetzt waren“) moniert Allmendinger. Auch seien Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger vernachlässigt worden: „Was macht es mit Menschen, wenn ihre Eltern sterben? Was macht es mit Müttern und Vätern, wenn ihre Kinder abgeschnitten sind von jeglicher Sozialität? Diese Fragen hätte man nach oben ziehen müssen und das haben wir leider viel zu spät getan.“
Es geht auch darum, Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen
Die Pandemie jetzt aufzuarbeiten, biete die Chance, das Vertrauen in die Institutionen und Politik zurückzugewinnen, ist Steinmeier überzeugt. „Ich glaube, dass die Aufarbeitung eine riesige Chance für die Demokratie ist, ich vertraue darauf, dass der neue Bundestag und eine neue Bundesregierung diese Chance auch sehen werden“, sagte der Bundespräsident. „Nach den jüngsten Wahlergebnissen ist die Aufgabe vielleicht noch dringender und größer geworden.“ Einen Versuch, die Corona-Pandemie in Deutschland aufzuarbeiten, gab es bereits. Im Jahr 2022 hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen Sachverständigenausschuss damit beauftragt, das Infektionsschutzgesetz zu evaluieren. Das Gesetz bildete den rechtlichen Rahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen. Doch endete die Evaluation in einem Datenchaos. Es habe keine kontrafaktische Evidenz gegeben, kritisiert Allmendinger, die zum Ausschuss gehörte. Das meint: „Wir brauchen im Prinzip eine Gesellschaft eins, wo so und so agiert wurde, und eine Gesellschaft zwei, wo diese Maßnahmen nicht ergriffen wurden. Und dann kann man sehen, welche Maßnahmen gewirkt haben und welche nicht. Diese Daten hatten wir damals nicht.“
In ihrem Abschlussbericht kritisierten die Sachverständigen zudem, dass es für die Auswertung zu wenig Zeit und Personal gegeben habe. Dennoch sei die Arbeit wichtig gewesen, etwa um eine bessere Datengrundlage anzustoßen, meint Allmendinger. „Aber eine Evaluation im engsten und eigentlichen Sinne ist das nicht geworden, weil es das nicht werden konnte.“
Weil es auf Bundesebene nicht voranging, wurden Länder aktiv
„Wir merken, egal worüber wir sprechen, dass wir immer noch mit den Spätfolgen der Corona-Pandemie zu tun haben“, sagt die sächsische Landtagsabgeordnete Iris Firmenich (CDU). Sie leitet die Enquete-Kommission „Pandemie“, die in der Corona-Zeit getroffene Maßnahmen und Entscheidungen evaluieren will. „Wenn wir das gut machen, können wir damit auch dazu beitragen, dass wir eine Versöhnung stiften.“
Die Enquete-Kommission besteht aus Mitgliedern aller Landtagsfraktionen – auch der AfD, die während der Pandemie immer wieder Desinformation verbreitet hatte. Zusätzlich kann jede Fraktion einen externen Sachverständigen auswählen, der ihr beratend zur Seite steht. Am 15. April will die Kommission mit einer allgemeinen Bestandsaufnahme starten, ehe verschiedene Bereiche wie der Gesundheitssektor genauer angeschaut werden. Bis Ende 2027 plant die Kommission, einen Abschlussbericht vorzulegen. Auch Brandenburg und Thüringen haben eine Enquete-Kommission eingesetzt. Dass die Bundesländer in Eigenregie handeln, sei wichtig, sagt Allmendinger. Sie findet, auch wissenschaftliche Einrichtungen sollten ihr Vorgehen während der Pandemie hinterfragen. Aber es brauche aus ihrer Sicht ein „zusammenführendes Organ“, besetzt mit „Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen und mit unterschiedlicher Erfahrung“, um das gesammelte Wissen dann zusammenzutragen.
In Europa ging Österreich mit einem Forschungsprojekt voran
Österreich ist schon einen Schritt weiter. 2023 hat die Regierung ein großangelegtes Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Corona-Krise initiiert. Beleuchtet wurden die großen kontroversen Themen: Impfpflicht, Schulschließungen, die Rolle der Medien, Wissenschaftsskepsis und die Organisation von Politikberatung. Zusätzlich wurden im Land Dialogveranstaltungen organisiert. Hauptautor Alexander Bogner, Soziologe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sagte, dass die Ergebnisse der Studie auf Deutschland übertragbar seien – und es gebe viel zu tun. Man müsse „eine Pandemie als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen begreifen und nicht nur als Gesundheitskrise.“ Die Politik müsse deutlich machen, dass Wissenschaft nicht mit absoluten Wahrheiten handelt, sondern vorläufige Erkenntnisse sammelt und dafür Zeit benötigt. Und: „Es wäre vertrauensbildend, politische Entscheidungsprozesse von wissenschaftlichen Erkenntnissen klar zu trennen und das auch zu kommunizieren.“ Das Verlangen nach wissenschaftlicher Expertise sei in der Politik bislang allerdings „überschaubar“. „Deutschland ist nach der Pandemie genauso aufgestellt wie vorher“, sagt Bogner. „Man würde wieder improvisieren.“ Ein Vorbild sei Großbritannien. Hunderte von Forschenden seien im Krisenfall in zahlreichen Untergremien am Start, um relevante Daten aufzuarbeiten und als Beratungsgrundlage zur Verfügung zu stellen. „Die Politik braucht breit aufgestellte Beratungsgremien, um der Komplexität solcher Krisen gerecht zu werden“, sagt Bogner. „Der virologische Tunnelblick war lange Zeit zu stark.“
Naht die nächste Pandemie?
Zu viel Zeit sollte sich Deutschland mit der Aufarbeitung nicht mehr lassen. „Wenn man sich die Infektionslage weltweit anguckt, sollten möglichst schnell die ersten richtigen Schlüsse daraus ziehen, sodass wir für die nächste Pandemie gewappnet sind“, mahnt Infektionsepidemiologe Ulrichs. Er spielt auf die Ausbreitung des Vogelgrippevirus H5N1 in den USA an. Der Erreger, der sich einst nur unter Vögeln verbreitete, ist dort nun auch bei Säugetieren wie Kühen, Hunden und Katzen nachweisbar. Es könnte nur eine Frage der Zeit sein, bis das Virus den Übergang zum Menschen schafft. Einzelne H5N1-Infektionen bei Menschen gab es bereits. – Es wäre vertrauensbildend, politische Entscheidungsprozesse von wissenschaftlichen Erkenntnissen klar zu trennen und das auch zu kommunizieren.
Quelle: Alexander Bogner in RN (DZ) vom 22. März 2025