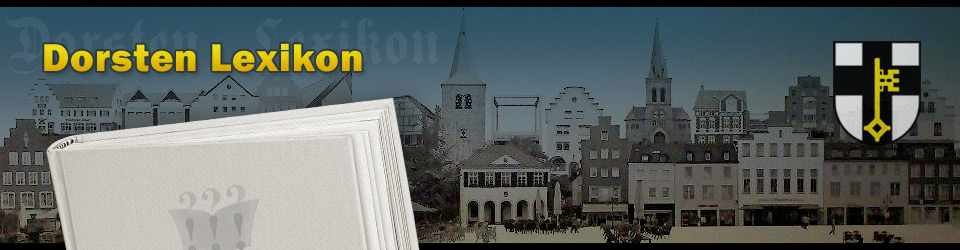Verfallenes und fehlende Hygiene zu etwas Liebenswertem verklärt
Von Wolf Stegemann – Zwei Alte sprechen: »Das war die gute, alte Zeit, / Sie war so schön und liegt so weit / in blauem Duft begraben, / Und von dem heutigen Geschlecht / Da weiss doch keiner wohl so recht, / Was wir verloren haben. / […] / Die heut im Jugendglanze stehn, / Im Rosenschmuck zu Tanze gehn, / Auch sie einst werden sagen: / »Sie war so schön, sie liegt so weit, / Die liebe, gute, alte Zeit / Aus unsern Jugendtagen!« – Heinrich Seidel (1842-1906).
Wenn von Dorsten die Rede ist, dann verbinden manche die Stadt mit dem Adjektiv „liebenswert“ vor allem dann, wenn man in der Rückschau Fotos des alten Stadt Dorsten anschaut. Dafür wurde jetzt über Facebook sogar herausgefunden, wie man ein solches Verhalten nennt: „Dorstalgie“. Daran beteiligen sich nicht nur Foto-Betrachter, sondern auch Journalisten, Autoren, Heimatfreunde und Heimatvereine. Zieht man schlaue Bücher zu Rate, was „liebenswert“ eigentlich bedeutet, dann erfährt man, dass das Wort nicht nur im 17. Jahrhundert sich aus „Liebelei“ entwickelt hat, im 19. Jahrhundert als „Flirt und flüchtige Liebe“ interpretiert wurde und sich daraus im 18. Jahrhundert auch das Wort „liebenswürdig“ entwickelte. Die Philosophen gehen schon mehr in die Tiefe und verbinden mit „liebenswert“ eine tiefe seelische Bindung, der die Liebe zugrunde liegt, dass man als liebenswert das sieht, was man eben sehen will. Damit genug mit Etymologie und philosophischer Ergründung.
Viehgebrüll und Seuchen durch Straßen und Häuser
Von denen, die alte Fotos von Dorsten aus der Zeit um die Jahrhundertwende 1900 bis zur Zerstörung der Stadt in den letzten Kriegswochen des Zweiten Weltkriegs 1945 betrachten, mögen die einen berührt sein von ihrem eigenen nostalgischen Anflug wehmütiger Erinnerungen, wie damals doch alles so schön und liebenswert war in dieser alten Stadt. Andere mögen distanzierter sein, auch das Reale betrachten, kopfschüttelnd die maroden Häuser in den engen Gassen, aus denen flüssiger Unrat aus den noch außen angebrachten Abtritten (beispielsweise Richarz’sche Haus am Westgraben) in die Gassen läuft. Visuell liegen Gerüche in der Luft. Im Gegensatz zu den Gerüchen in den engen Gassen der Marktplatz mit den hinführenden Hauptstraßen, wo die Wohlhabenden hinter schönen alten Giebeln wohnten und hinter großen Glasscheiben ihre Waren feil boten. Geschmückt nach draußen – aber drinnen? Klein, eng, unhygienisch auch dort. Kaschiertes Leben zwischen immer wieder neu aufkommenden Seuchen und Krankheiten und üblen Gerüchen einer solchen engen Stadt mit Gassen, in denen mitten unter den Bewohnern die Metzger ihre Ställe mit dem brüllenden Vieh hatten und Gerber ihr anrüchiges Handwerk betrieben. Wie gesagt: mitten in der Stadt zwischen Wiesenstraße und Ursulastraße, zwischen Hühnerstraße und Recklinghäuser Straße. Von der „eleganten Stadt“, wie sie 1598 Hamelmann beschrieben und Matthaeus Merian 1643 Dorsten mit „Grandezza“ noch bezeichnet hatte, ist entweder im Laufe der Jahrhunderte nicht mehr viel übrig geblieben oder die Sichtweise hat sich geändert – oder auch beides. Die alten Häuser sind bröckelnden Steinhaufen geworden. Die totale Zerstörung der Stadt im letzten Krieg ließ Dorsten neu entstehen. Aus Altem wurde Neues. Weggebombt waren die bröckelnden Häuser und Modernes entstand zweckausgerichtet in alten Strukturen.
Haus- und Landarbeit forderte unvorstellbare Opfer
In der Alterserinnerung an die verlorene Kindheit aber bleibt das Alte bestehen, mutieren der Gestank in den Gassen zum Abenteuer, das wöchentliche Reinigungsbad im Wasserschaff für alle Kinder der Familie zur liebenswerten Normalität und das Herumklettern auf Bäumen und maroden Mauern zur Einmaligkeit. Für etliche alternde Heimatfreunde erscheint das Leben in jener Zeit ohne Waschmaschine und Kühlschrank, ohne fließendes Wasser und ausreichende medizinische Versorgung – aber mit Plumpsklo – nicht nur liebenswert, sondern auch lebenswerter gewesen zu sein, glaubt man ihren veröffentlichten Schilderungen. Das alles ist ein normaler Vorgang in der Betrachtungsweise im Alter auf lange Zurückliegendes. Dabei waren Haus- und Landarbeit unsäglich hart, die Opfer forderten und nicht nur die Kindheit, die im täglichen Arbeitsprozess in den Handwerker- und Bauernfamilien verloren ging. Dieses Leben wird mitunter von Heimatvereinen nachgespielt und dabei nicht nur mit Begeisterung über die „gute alte Zeit“ geredet sondern auch mit der körperlichen Gesundheit von heute Stroh gedroschen und Garben gebunden. Carl Ridder, bekannt durch seine in der Lokalzeitung und in Büchern veröffentlichten Erinnerungsspaziergänge, schrieb:
„Es ist etwas Eigenes um diese Stadt, um ihre Straßen und kleinen, winkeligen Gassen. Gassen, die ein Spitzweg hätte lieben müssen, da sie ein Zauber mittelalterlicher Romantik umweht. […] Wer einmal vor Jahren – wo noch keines Menschen Hand die schwarzen Gründe des Flusses umwühlt, wo noch das Gehämmer den Fleiß dieser Menschen verriet – diese Stadt gekannt, der wird schmerzlich vermissen jenes Bild, das nie wiederkehrt. […] Die Zeit und der Realismus des Lebens waren härter, sie nahmen mit gieriger Hand dieses Stück Romantik und fragten nicht nach wehen Gedanken des anderen. Das Brückenhaus ist fort, die alten Kastanien blühen nicht mehr, auf den Schiffswerften rosten die Nägel, an den Ufern des alten Flusses schaufeln die Bagger, nur die Heimat ist noch wie sonst…“
Not, Hunger, Krankheiten und Schmutz beherrschten die Stadt
Diese schönen Worte lassen außer Acht, was „mittelalterlicher Zauber“ wirklich war: Not, Folter, Tod, Hexenverbrennung, Hungersnöte, Krankheiten, Epidemien, Schmutz und Höllenangst. Und der schwarze Grund des Flusses? Hat nicht die Lippe bekanntlich seit dem 17. Jahrhundert stets Hochwasser geführt und Straßen, Plätze und Höfe unter Wasser gesetzt, bis sie von Menschenhand gedämmt und dadurch Schaden an Personen, Vieh und Sachen verhindert werden konnte? Auch Josef Wiedenhöfer, Direktor des Gymnasium Petrinum, beschwor die gute alte Zeit in seiner 1928 niedergeschriebenen Erinnerung als göttlichen Zauber, ähnlich wie ihn Odysseus erfuhr, als er seine alte Heimat Ithaka wieder erkannte. Allerdings bemühte sich Wiedenhöfer auch, die „umwälzenden Erinnerungen verständlich und vielleicht ein wenig liebenswert (zu) machen“, auch wenn er den Kanal als seelenlos empfand:
„Es ist ein hartes Schicksal für die uralte Stadt Dorsten, dass an ihrer Nordseite nun nicht mehr der lieblich gewundene Fluss zwischen freundlichen Ufern seine ruhiges Wasser zum Rhein trägt, sondern dass hier zwischen hohen Dämmen eine künstliche Wasserstraße starr und seelenlos hinstreicht.“
Josef Wiedenhöfer erkennt auch, wie ungesund Dorsten früher war: „Beim Rundgang auf den Wällen beschatten die alten Ulmen dich nicht mehr. Der Ost- und Südwall wird soeben zur Durchgangsstraße ausgebaut und für die Straßenbahn verbreitert. Auch manches Unschöne und Ungesunde ist an den Wällen verschwunden. Überhaupt ist das kanalisierte Dorsten heute mehr als früher eine gesunde Stadt …“ Immer wieder wird von denen, die sich mit dem alten Dorsten befassen, die Stadt und die früheren Zustände in ihr als „liebenswert“ beschrieben, ein Wort, wie es auch der Archivar Paul Fiege, der ansonsten ein distanziertes Bild von der Stadt dokumentiert, lapidar benutzt hat. In Heimatkalendern, Schriften der Dorstener Altstadtschützen, in anderen Festschriften und Sammelbänden alter Fotos werden bis heute immer wieder nostalgische Schwärmereien über die „gute alte Zeit“ veröffentlicht, als ob es erstrebenswert wäre, damals gelebt zu haben. Junge Leute fragen sich natürlich, was hat es auf sich mit dieser Altersnostalgie, die das Schlechte verdrängt und nur das vermeintlich Gute sieht? Ein mehrstrophiges Gedicht der Dorstener Schriftstellerin Gerda Illerhues, veröffentlicht im Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck und Dorsten, fängt unter dem Titel „Erinnerungen an Dorsten“ so an:
Denk ich an die Vergangenheit, / an die gute, alte Zeit, / an viele wunderschöne Tage, / denk ich an Dorsten, ohne Frage…
Der „guten alten Zeit“ nachzutrauern ist krankmachendes Heimweh
In der Medizin wird der 1688 erstandene Begriff „Nostalgie“ als ein „krank machendes Heimweh“ bezeichnet und dargestellt. Erst viel später hat Nostalgie die heutige nicht-medizinische Bedeutung erhalten. Die Wissenschaft sagt, dass die Nostalgie im Deutschen „eine wehmütige Hinwendung zu vergangenen Zeiten“ bedeutet, „die in der Erinnerung oftmals stark idealisiert und verklärt reflektiert wird“. Nostalgie ist ein „Hinterhertrauern der guten alten Zeit“, in der angeblich alles viel schöner und besser war als es in der Gegenwart ist. Beispielsweise im „Goldenen Zeitalter“ oder in den „Fünfziger Jahren“. In den Verklärungen der Vergangenheit werden oft Attribute verwendet wie Ordnung, Anstand und Moral. – Ja damals, damals war die Welt noch in Ordnung!