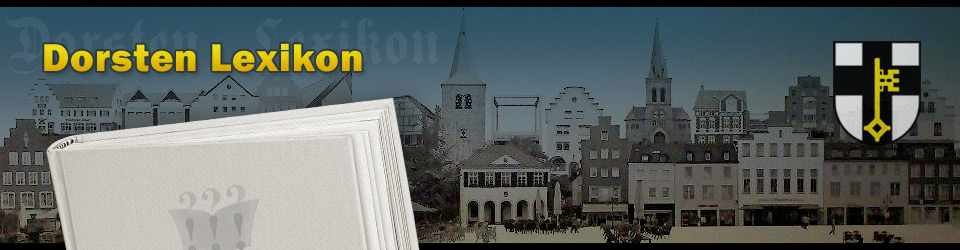Es wurden so viele Kinder geboren wie nicht zuvor in der Bundesrepublik
1964 wurden 1.357.304 Mädchen und Jungen geboren – so viele wie noch nie im Nachkriegsdeutschland. Der Politiker Michael Müller und die Ärztin Ulrike Venschott-Jordan berichteten über meist gut erlebte Zeiten, die dennoch nie sorglos waren. – Es dauert nicht mehr lang, dann ist es so weit: Michael Müller, der mal Regierender Bürgermeister von Berlin war, wird 60 Jahre alt. „Ich habe den Beginn des 60. Lebensjahrs groß gefeiert, den 59. Geburtstag“, sagt der Sozialdemokrat in seinem geräumigen Bürgerbüro in Berlin-Charlottenburg. Aber wie er den 9. Dezember 2024 verbringen wird, das war bei ihm im Januar noch „völlig offen“. Bei Ulrike Venschott-Jordan ist das anders. Sie hat den runden Geburtstag nämlich bereits hinter sich. An jenem 26. Juni 2024 – ein Tag mitten in der Woche – lud die Berliner Ärztin Freunde zu Bier, Wein und Fingerfood auf den Rüdesheimer Platz im Stadtteil Wilmersdorf. Es war ein herrlich lauer Sommerabend unter hohen Bäumen.
1964er sind Hape Kerkeling, Caroline Link, Ilse Aigner, Henry Maske
Michael Müller und Ulrike Venschott-Jordan sind etwas Besonderes, weil sie dem Jahrgang 1964 angehören. Er ragt selbst in der berühmten Babyboomer-Phase noch einmal heraus. Die 1964er sind nämlich Deutschlands stärkster Jahrgang überhaupt. 1.357.304 Mädchen und Jungen kamen damals auf die Welt – 1.065.437 im Westen, 291.867 im Osten. Darunter waren der Boxer Henry Maske, der Komiker Hape Kerkeling, die Regisseurin Caroline Link oder die CSU-Politikerin Ilse Aigner. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr erreichte die Geburtenzahl mit 692.989 nur ungefähr die Hälfte. Der Boom war ein Beleg dafür, dass zumindest die Westdeutschen zuversichtlich in die Zukunft blickten – so wie der Geburtenrückgang im Ostdeutschland der 1990er-Jahre die ökonomische und soziale Krise bezeugte.
Der 60. Geburtstag ist für die meisten Menschen persönlich einschneidend
Gemessen am Durchschnittsalter der Deutschen sind drei Viertel des Lebens an jenem Tag vergangen – je nach Geschlecht und Gesundheit können es noch ein paar Jahre mehr, aber auch deutlich weniger werden. Deshalb machen sich die Betroffenen, je nach körperlicher Verfassung und Gemütszustand, mehr oder weniger Gedanken. Zugleich hat das Vorrücken der 64er auf das Rentenalter eine gesellschaftliche und politische Bedeutung. Denn es handelt sich um eine Altersgruppe mit sehr spezifischen Erfahrungen – und eine, die allein aufgrund ihrer Größe eine enorme Lücke reißen wird, auf dem Arbeitsmarkt ebenso wie in der Rentenkasse. Man kann da durchaus von einer Zäsur sprechen, wenn auch von einer unter vielen Zäsuren in diesen, wie Soziologen sagen, „disruptiven Zeiten“. Das Persönliche wie das Politische bildet sich in den Gesprächen mit den Geburtstagskindern deutlich ab.
Kontrast zu heutigen Teenagern
Michael Müller stammt aus Berlin-Tempelhof. Dort ging er zur Schule, ließ sich nach der Mittleren Reife zum Bürokaufmann ausbilden und arbeitete bis 2001 als Drucker im Betrieb des Vaters. Welches Gewicht die Geschichte für ihn hat, zeigt auch das Bürgerbüro. Dort hängt über einem Setzkasten aus dem väterlichen Betrieb ein Foto von Jürgen Müller. Der Sohn bedauert, „dass die alten Handwerksberufe weg sind. Kürschner, Sattler, Buchdrucker – das gibt es alles nicht mehr.“ Mit den Berufen verschwinden die dazugehörigen Worte.
Wenn Michael Müller an seine Teenagerjahre und die Zeit danach zurückdenkt, kommt er trotzdem ins Schwärmen. „Die 80er-Jahre waren großartig in Berlin“, sagt er. „Es war diese besondere, auch morbide Situation in der geteilten Stadt. Es war alles möglich. Ich war jung, wollte alles sehen und alles in Anspruch nehmen. Die 80er waren super.“ Es gab Interrail, Kassettenrekorder, Abba und die Talking Heads. Der Kontrast zu den Gefühlen heutiger Teenager könnte kaum größer sein.
Ulrike Venschott-Jordan hat es genauso empfunden
Sie stammt aus dem katholischen Münsterland, hat in Düsseldorf eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und kam anschließend zum Medizinstudium nach West-Berlin. „Das war für mich eine große Befreiung: raus aus dem Schichtdienst, rein ins Studentenleben – und überhaupt diese wunderbar freie und tolerante Stadt“, sagt sie. „Ich lebte in einer der spannendsten Städte der Welt.“
Beide haben Familien gegründet, wurden Eltern von jeweils zwei Kindern, die heute Mitte 20 sind, und waren beruflich erfolgreich. Müller zog 1989 ins Berliner Abgeordnetenhaus ein und stieg 2001 zum Vorsitzenden der SPD-Fraktion auf. 2011 wurde er Senator für Stadtentwicklung und Umwelt und 2014 schließlich Regierungschef der mittlerweile wiedervereinigten Hauptstadt. Venschott-Jordan schloss das Studium ab und hat seit 2007 mit zwei Partnern, einer davon ist ihr Mann, eine große Praxis für Diabetologie. Für ihn und für sie sind die 60 Jahre im Ganzen also relativ glattgelaufen – mit dem Unterschied, dass seine Karriere öffentlich stattfand. Es gab weder Schicksalsschläge noch materielle Sorgen. Beide wuchsen in eine prosperierende Bundesrepublik Deutschland hinein, die ihre Lehren aus dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg gezogen zu haben schien.
Bundesrepublik ein Wirtschaftswunderland, in der DDR boomte nichts
Der Leipziger Kultursoziologe Bernd Lindner sagte denn auch dem „Spiegel“: „Die West-Boomer sind in ein Wirtschaftswunderland hineingeboren, sie hatten beste Entwicklungs- und Karrierechancen. In der DDR boomte gar nichts. Im Osten war es ganz anders als im satten Westen.“ Wobei Ostberlin im real existierenden Sozialismus wiederum satter schien als der Rest. Andererseits war im Westen ebenfalls nicht alles eitel Sonnenschein. „Viele meiner Klassenkameraden haben 40 Bewerbungen schreiben müssen, bis sie einen Ausbildungsplatz hatten“, sagt Müller. „Das war auch nicht lustig für junge Leute.“ Vielmehr habe „immer ein unheimlicher Konkurrenzkampf“ geherrscht, „weil so viele da waren. Meine Kinder haben es da leichter. Denn heute werden überall Leute gebraucht.“ Manch Akademiker fürchtete, aus dem Nebenjob des Taxifahrers nicht wieder herauszufinden.
Die 64er waren nicht stets auf Rosen gebettet
Ulrike Venschott-Jordan hat den Konkurrenzkampf selbst erlebt: Sie schrieb nicht 40, sondern sogar mehr als 50 Bewerbungen. Erst dann war ihr die Ausbildung zur Krankenschwester sicher. Dies steht im Widerspruch zu dem verbreiteten Klischee, dass die 64er stets auf Rosen gebettet gewesen wären. Politisch scheint manche Rückschau ebenfalls ein wenig verklärend. „Wir haben ein Riesenglück gehabt, weil wir nie Krieg oder Not erlebt haben“, sagt Müller zwar. „Für mich war die Demokratie lange selbstverständlich“, sagt Ulrike Venschott-Jordan. Allerdings erinnert er an den Terror der „Roten Armee Fraktion“ und sie sich an die Sirenen, die in den 1980er-Jahren immer samstags um 12 Uhr in der münsterländischen Heimat heulten – nicht zu vergessen die tieffliegenden Starfighter von einem nahe gelegenen Luftwaffenstützpunkt. „Es herrschte Kalter Krieg, und der Nato-Doppelbeschluss versetzte uns in Angst“, betont Ulrike Venschott-Jordan. So fuhr sie 1981 mit 17 Jahren zur Friedensdemo in den Bonner Hofgarten, so wie Hunderttausende andere. Es war ein generationenprägendes Erlebnis, das beweist: Für Deutschlands stärksten Jahrgang ging am Ende alles gut. Aber es hätte eben auch schlecht enden können.
2024 sieht die Welt ganz anders aus – persönlich und politisch
Müller ist seit 2021 Mitglied des Bundestages und will im nächsten Jahr erneut kandidieren. Nein, er habe den teilweise erzwungenen Wechsel aus dem Roten Rathaus nicht als Abstieg erlebt, sagt der Sozialdemokrat. „Das Bundestagsmandat ist etwas völlig anderes, und das finde ich gut.“ Müller gehört dem Auswärtigen Ausschuss an, ist Vorsitzender der Enquete-Kommission, die den Afghanistan-Einsatz aufarbeitet, und im Parlament Berichterstatter für Asien und den Nahen Osten. „Da gibt es nichts zu klagen.“ Im Gegenteil, er hat nach eigener Wahrnehmung „mehr Freiheiten gewonnen“ und kann sogar mal in Jeans im Hohen Haus erscheinen. „Insofern hat sich für mich alles gut gefügt.“ Lediglich die Erfahrung, immer öfter der Älteste zu sein, bleibt Müller so wenig erspart wie dem Rest seines Jahrgangs. Das hat etwa zur Folge, dass er Netzwerke neu knüpfen muss, weil die alten altersbedingt nicht mehr tragen.
Ulrike Venschott-Jordan hatte zuletzt Grund, stolz auf Erreichtes zu sein
Ihre Schwerpunktpraxis wurde von der Deutschen Diabetesgesellschaft als Exzellenzzentrum zertifiziert. „Das hätte ich sicher nicht allein geschafft“, sagt sie und würdigt ihren Mann und ihr Praxisteam. Die Medizinerin will ohnehin noch eine ganze Weile weiterarbeiten, trotz wachsender Bürokratie und steigender Praxiskosten. Sie macht sich aber Gedanken über die spätere Übergabe, damit die Patienten insgesamt weiter gut versorgt werden. „Denn nach der Ärzteschwemme steht uns nun ein erheblicher Ärztemangel bevor, und die wenigen Ärzte müssen dann uns viele Alten versorgen.“
Überhaupt: die Zukunft und die bange Frage, wie es weitergeht auf der Welt. Venschott-Jordan zählt die Schrecken der vergangenen Jahre auf, vom Brexit bis zu Russlands Angriff auf die Ukraine, und sagt: „Es war leicht und etwas naiv, Pazifistin zu sein in Zeiten, in denen die Nato unter Führung der USA unsere Verteidigung garantierte.“ Daher will sie die kommenden Generationen „nicht durch Rückzug ins Private mit all den Problemen alleinlassen. Es braucht unser politisches und gesellschaftliches Engagement, um ein weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft zu verhindern.“ Da kann Michael Müller einmal mehr beipflichten. „Es ist ein berechtigter Vorwurf, dass sich meine Generation mit wichtigen Fragen wie dem Klimaschutz zu wenig auseinandergesetzt hat“, sagt er. „Es herrschte Sorglosigkeit, weil es über viele Jahre gut ging. Ich verstehe, wenn Leute heute sagen: Da ist vieles schiefgelaufen.“ Doch eben, weil dies den 60-Jährigen „jetzt dramatisch bewusst“ werde, wollten sie für Kinder und Enkel mehr tun. „Ich nehme keine Uns-doch-egal-Haltung wahr – sondern den Wunsch, vieles noch zu korrigieren.“ Privates erscheint da nicht mehr ganz so wichtig.
Von Ausnahmen abgesehen. „Man hat vielleicht noch 15 Sommerurlaube vor sich“, sagt Michael Müller, sehr nüchtern und ohne einen Anflug von Melancholie. „Da muss man überlegen, was man noch nicht gesehen hat.“ Und, was hat der bald 60-Jährige bisher nicht gesehen? „Lissabon“, antwortet er, „da war ich noch nie.“
Quelle: RN (DZ) vom 5. Januar 2025
Kein passender Begriff gefunden.