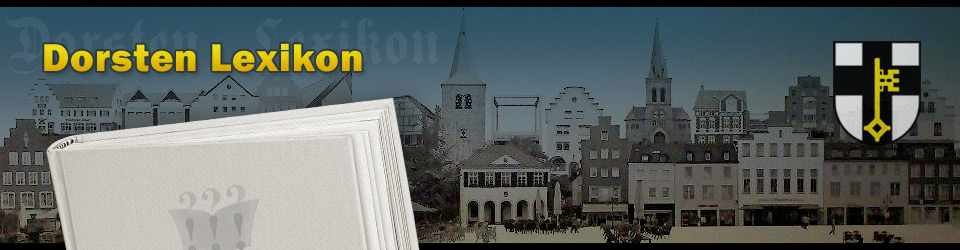Professuren in Australien, China, Südafrika und den USA
1929 in Troppau/Sudetenland bis 1999 in Münster; Professor für Englische Philologie. – Nach der 1945 erfolgten Ausweisung seiner Familie aus dem Sudetenland fasste die Familie in Dorsten Fuß. Herbert Mainusch konnte am Gymnasium Petrinum seine unterbrochene Schulausbildung 1949 in Dorsten mit dem Abitur abschließen und in Münster ein Studium der Fächer Englische und Deutsche Philologie sowie Philosophie aufnehmen. 1965 wurde er mit seiner Dissertation über die „Dichtungstheorie Sir Philip Sidneys“ promoviert. Nach kurzem Zwischenaufenthalt im Schuldienst kehrte er an die Universität Münster zurück und habilitierte sich 1969 mit einer Arbeit über „Romantische Ästhetik“.  1970 wurde er zum außerplanmäßigen Professor ernannt und 1972 zum ordentlichen Professor für Englische Philologie an der Universität Münster berufen. Bis zur Emeritierung 1994 war er in vielen Ämtern und Funktionen tätig. Er war nicht nur mehrfach Geschäftsführender Direktor des Englischen Seminars, sondern überdies Dekan des früheren Fachbereichs Anglistik, Dekan der Philosophischen Fakultät sowie Mitglied des Senats. Auch außerhalb der Universität Münster engagierte sich Prof. Mainusch u. a. als Gründungssenator der Gesamthochschule Essen sowie als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Deutschen Institut für Fernstudien. Darüber hinaus war er in Münster viele Jahre Vorsitzender des Träger- und Fördervereins des Wolfgang-Borchert-Theaters.
1970 wurde er zum außerplanmäßigen Professor ernannt und 1972 zum ordentlichen Professor für Englische Philologie an der Universität Münster berufen. Bis zur Emeritierung 1994 war er in vielen Ämtern und Funktionen tätig. Er war nicht nur mehrfach Geschäftsführender Direktor des Englischen Seminars, sondern überdies Dekan des früheren Fachbereichs Anglistik, Dekan der Philosophischen Fakultät sowie Mitglied des Senats. Auch außerhalb der Universität Münster engagierte sich Prof. Mainusch u. a. als Gründungssenator der Gesamthochschule Essen sowie als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Deutschen Institut für Fernstudien. Darüber hinaus war er in Münster viele Jahre Vorsitzender des Träger- und Fördervereins des Wolfgang-Borchert-Theaters.
Liebe zur Literatur-, Musik- und Kunsttheorie
Herbert Mainusch war ein weit gereister, kultivierter Kosmopolit. Er übernahm Gastprofessuren in Australien, Südafrika, Sri Lanka, den USA und der Volksrepublik China. Die Akademie der Wissenschaften in Shenyang/China wählte ihn 1992 zum Honorarprofessor und zu ihrem ordentlichen Mitglied. 1993 wurde er, ebenfalls in China, Ehrenprofessor der Universität Dalian. Die in seiner Dissertation und Habilitationsschrift bereits erkennbare Liebe zu Literatur-, Musik- und Kunsttheorie hat Prof. Mainusch zeitlebens nicht verlassen. In zahlreichen Büchern erwarb er sich auf diesem Gebiet den Ruf eines weit über Deutschland hinaus weisenden Wissenschaftlers, eines im besten Wortsinn „an-stößigen Querdenkers“, der der Routine des philologischen Betriebs stets skeptisch begegnete und der seine Studierenden mit Elan und Enthusiasmus auf das Selberdenken verpflichtete. Nicht zufällig galt seine Abschiedsvorlesung Ende Juni 1994 im überfüllten Auditorium Maximum der Universität Münster den gegen den Stachel löckenden Paradoxien Oscar Wildes.
Mertner/Mainusch: „Pornotopia“ – Das Öbszöne in der Literatur
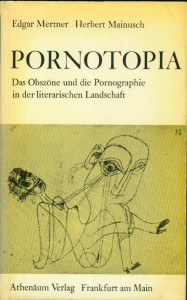 Aufsehen sowohl in der literarischen wie auch in der wissenschaftlichen Fach-Szene erregte Prof. Mainusch, als er 1970 zusammen mit dem Anglisten Prof. Edgar Martner (Münster) das Buch über „Das Obszöne und die Pornographie in der literarischen Landschaft“ (so der Untertitel) vorlegte, das unter dem Titel „Pornotopia“ eine Auftragsarbeit für das NRW-Arbeits- und Sozialministerium war und vom renommierten Frankfurter Athenäum-Verlag herausgegeben wurde. Während dem richtigen Leben mit und in der Liebe Problemen nur so anhaften, gibt es in der Literatur zum Thema weder Potenzangst noch Bindungs-Verantwortung, weder Sexualtabus noch nichtsexuelle Strebungen, weder Eifersucht noch Mitgefühl, weder Stolz noch Ekel, weder Schwängerungswunsch noch Schwängerungsfurcht, weder Klassenschranken noch Emanzipationsbedürfnisse. Das macht, weil den Einwohnern von Pornotopia ein eigenartig unmenschlich (oder übermenschlich) eindimensionales Wesen verliehen ist: Sie sind Menschen ohne Eigenschaften oder genauer, mit einer einzigen – der Geilheit. So beschrieb der „Spiegel“ Mainuschs Buch.
Aufsehen sowohl in der literarischen wie auch in der wissenschaftlichen Fach-Szene erregte Prof. Mainusch, als er 1970 zusammen mit dem Anglisten Prof. Edgar Martner (Münster) das Buch über „Das Obszöne und die Pornographie in der literarischen Landschaft“ (so der Untertitel) vorlegte, das unter dem Titel „Pornotopia“ eine Auftragsarbeit für das NRW-Arbeits- und Sozialministerium war und vom renommierten Frankfurter Athenäum-Verlag herausgegeben wurde. Während dem richtigen Leben mit und in der Liebe Problemen nur so anhaften, gibt es in der Literatur zum Thema weder Potenzangst noch Bindungs-Verantwortung, weder Sexualtabus noch nichtsexuelle Strebungen, weder Eifersucht noch Mitgefühl, weder Stolz noch Ekel, weder Schwängerungswunsch noch Schwängerungsfurcht, weder Klassenschranken noch Emanzipationsbedürfnisse. Das macht, weil den Einwohnern von Pornotopia ein eigenartig unmenschlich (oder übermenschlich) eindimensionales Wesen verliehen ist: Sie sind Menschen ohne Eigenschaften oder genauer, mit einer einzigen – der Geilheit. So beschrieb der „Spiegel“ Mainuschs Buch.
Mertens und Mainusch untersuchten psychologisch-psychoanalytisch diese Geilheit in der Weltliteratur von Aloysia Siega und Fanny Hill über Pauline, Josefine Mutzenbacher, den Memoiren der Sängerin und derjenigen der russischen Prinzessin bis hin zu Darling und Barbara. Eine pornografische Heldin folgt der anderen.
Trotz der irrealen Erotik- und Pornodarstellungen, die in der Literatur Märchen-Charakter haben, schreibt Mainusch den Geschichten in Ausnahmefällen Kunstqualitäten zu, wie beispielsweise der „Geschichte der O“. Hier erreicht die ewig-menschliche Knecht-Herr-Beziehung durch Transposition ins Sexuelle eine vereinfachende und verdichtende Überhöhung, die den Roman zum Kunstwerk adelt. Oder Frank Newmans „Barbara“ könnte in der Kategorie der anarchisch-naturverbundenen Vagabundenromane ein pornographisches Gegenstück sein zu Eichendorffs „Taugenichts“, Hausmanns „Lampioon“, Steinbecks „Straße der Ölsardinen“.
Kunst ist ihrer Natur nach immer anstößig
Mainusch und sein Mitautor gehen davon aus, dass Kunst ihrer Natur nach anstößig ist, weil sie Neues anstößt, doch muss dabei die Reflexions-Freiheit des Lesers unangetastet bleiben, ja gefördert werden. „Insbesondere die Schamverletzung im obszönen Kunstwerk stellt nicht die Moral in Frage, sondern die Frage nach der Echtheit der Moral und damit nach der Echtheit unserer Existenz.“ Die Autoren stellen ihre Kunst-Definition verwandten und gegensätzlichen aus vielen Jahrhunderten gegenüber: Aristoteles und Horaz, Milton, Schiller, Goethe, August Wilhelm und Friedrich Schlegel, Jean Paul, Hegel, Schleiermacher und schließlich Ernst Fischer, Muriel Spark und Adorno. Dass Mainusch nur wenig Büchern die Ehre der Einstufung als obszöne Kunstwerke zuteil werden lässt, Henry Millers und Jean Genets Hauptwerken und Aretinos „Ragionamenti“, wäre akzeptierbar, nicht aber, dass die unterschiedlichsten und ungleichwertigsten Schriften in der Kategorie „Pornographie“ über einen Leisten geschlagen werden. In dieser Klasse finden sich Kinseys wissenschaftliche Pionierleistung mit ihren trockenen Statistiken neben de Sades phantasieverstiegenen, monomanen Zwangswiederholungen, volkskundliche Sammlungen von Sexual-Bräuchen neben „harten Pornos“ und Wirtinnen-Verse neben der (zugegebenermaßen dünnen und faden, aber sicher nicht in Pornotopia beheimateten) Groteske „Candy“.
– Spiegel Nr. 32/1970
Quellen:
Westfälische Wilhelms-Universität Münster (idw), 16. Juni 1999. – „Spiegel“ Nr. 32/1970.