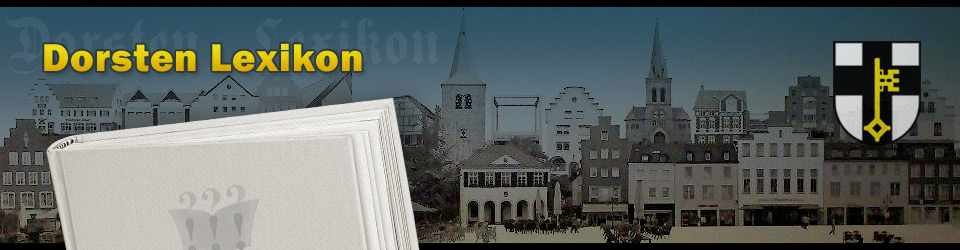Es war hart, arbeitsreich, krankheitsgezeichnet und voller Entbehrungen
Wie Bauern um 1850 auf ihren Höfen lebten, mag heute wie ein Märchen klingen. Allerdings war nichts Märchenhaftes dabei. Es gab keine Maschinen, kein elektrisches Licht und keine Wasserleitung. Von morgens bis in die Nachtstunden hinein hatte jeder die Hände voll zu tun: der Bauer, die Bauerin und das Gesinde. Selbst die Kinder mussten besonders zur Saat- und Erntezeit mit anpacken. Noch bevor der Tag anfing, hantierten die Magd im düsteren Schein der Öllampe in der Küche und der Knecht mit der Stalllaterne zwischen den Pferden und Kühen. Dreimal täglich wurde gemeinsam gegessen. Im Zwielicht des Morgens eine „Mehlpappe“ mit eingebrocktem Schwarzbrot auf der Diele des Hauses. Kaffee kannte man zumindest an Werktagen nicht, ansonsten auch kaum. Um Mittag gab es Gemüse, vor allem Sauerkraut mit Bohnen und Speck. Abends kam Milchsuppe und Buchweizenpfannkuchen mit einem Schinkenbutterbrot zum Tagesabschluss auf den Tisch.
Gegessen mit Rosenkranz und Tischgebeten
War Schlachtzeit, aß man Pannas und Wurstebrot. Am offenen Herdfeuer verrichteten alle Hausbewohner gemeinsam Rosenkranz- und Tischgebete. Und danach erzählte man sich Geschichten. Der Großvater wusste das Meiste aus der Nachbarschaft zu berichten, die Großmutter hatte alle Familiengeschichten parat. Und wenn das Feuer erlöschen wollte, nahm man den Püster und blies es wieder an. Am Haken hing funkenumflittert der schwarze Kessel. In der Vorweihnachtszeit waren die Erwachsenen schon um zwei Uhr nachts auf der Tenne und droschen das Getreide aus der Scheuer mit Flegeln im Zweier-, Dreier- und Vierertakt. Die Kirchenglocken riefen dann die Großmutter und die Schulkinder zur Messe. Die anderen fegten die Tenne. Um Mittag ging es an eine neue Lage, die abends wieder weggeschafft sein musste. Beim Dreschen sprach der Bauer: „Der Teufel macht mir wenig Not, / ich pflüg’, ich grab’, ich dresch’ ihn tot!“
Der Winter war keine gute Zeit fürs Vieh – auf der Egge zur Weide gefahren
Das Vieh hatte nicht immer eine gute Zeit. Der sandige Boden brachte nur wenig Stroh. Sumpf- und Bruchgras schmeckte sauer. So magerten die Kühe gegen das Frühjahr ab und gaben fast gar keine Milch mehr. Manche legten sich nieder und konnten vor Schwäche nicht wieder aufstehen. Da mussten dann die Nachbarn helfen, sie wieder auf die Beine zu stellen. Es kam sogar vor, dass manche Tiere den Weg zur Weide nicht aus eigener Kraft zurücklegen konnten. Darum legte man das Tier auf die Eggeschleife, um es mit Pferdekraft zur Weide zu ziehen. Dort fraß das Tier das Gras erst in Reichweite und erholte sich langsam. Man kannte noch keinen Kunst- oder Handelsdünger, der erst kurz nach 1850 durch Justus Liebig bekannt wurde. Stroh diente zur Nahrung des Viehs. Als Einstreu verwendete man Heidegras und Heidekraut. Heideplaggen diente zur Vermehrung des Naturdungs. Auf Bauernhöfen mangelte es vielerorts an Sauberkeit. Die Arbeit machte Hände und Kleidung schmutzig. Die Seife war knapp und Badeöfen gab es kaum. Die Kinder fehlten wochenlang in der Schule, wenn die Arbeit auf dem Hof drängte. So war es mit Lesen und Schreiben oft schlecht bestellt. Mit Federhalter und Rasiermesser konnten Bauern nicht gut umgehen, und so wurden sie denn als „dumm“ und „dreckig“ bezeichnet und gar zu leicht von den „feinen“ Stadtleuten verachtet.
Dennoch Tanz und Vergnügen
Trotzdem verlief das Leben auf dem Bauernhof in den fälschlicherweise oft als „gute alte Zeit“ apostrophierten Jahrzehnten nicht ohne Glücksmomente. Sonn- und Feiertage, Kindtaufen, Hochzeiten, Erntefeste, Besuche, Spinnstuben, Schützen- und Schlachtfeste brachten mancherlei Abwechslung und Freude. Vor allem sorgten Väterbrauch und alte Sitten, das Nachbar- und Notnachbarrecht für gemeinsame Fröhlichkeit, aber auch für Hilfe in Notzeiten, bei Unglücken, Seuchen, Brand, Tod und Begräbnis.
Das Bauernleben um 1850 war einfach, hart, arbeitsreich. Mägde und Knechte und das übrige Gesinde blieben bis zu ihrer Hochzeit, oft das ganze Leben auf dem Bauernhof und wurden wie Verwandte behandelt, manchmal aber auch nicht. Es gab einen großen sozialen Unterschied zwischen Bauer und Gesinde, der je nach Charakter des Bauern herausgestellt oder überdeckt wurde. Für den Wechsel der Arbeitskräfte galten der Mai und Martini als herkömmliche Zeiten.
Zwei authentische Beschreibungen
Amtmann Franz Brunn schrieb zwischen 1840 und 1842 in die amtliche Chronik über die Wohnweise der Bauern:
„Sie bewohnten ein Haus, welches je nach dem Bedürfnisse aus mehreren hölzernen Gebinden bestand, die durch Lehmwände ausgefüllt waren. Das Dach war mit Stroh eingedeckt. In einem oder zwei Seiteneinbauten war die Stallung fürs Vieh und einige Kammern und Bühnen zu Schlafstellen angebracht. Der mittlere Raum diente als Dreschtenne und im oberen Teile waren Herd und Küche, wo die ganze Haushaltung um ein großes Feuer ihren Platz, Licht und Wärme fand.
Die Hausmutter konnte vom Herde aus das ganze Hausgesinde und zugleich das Vieh überschauen. Schornsteine kannte man erst später. Früher fand der Rauch seinen Ausgang durch ein kleines Fenster. In späterer Zeit trennte man auch die Küche und die Tenne vermittelst zweier großer Flügeltüren (Windfang) doch so, dass diese offengestellt, beim Einfahren die Pferde bis an den Herd geführt werden und die Hausfrau beim Dreschen wenigstens das Stroh umwenden konnte. Später wurden hie und da in besonderen Anbauten Stuben für Weben und Spinnen angebaut und die Strohdächer und Lehmwände mit Ziegeln ersetzt, statt der Lehmflure in die Kammern Bretterflure gelegt, und allmählich die Häuser bis zur jetzigen Bequemlichkeit gebracht.“
Der französische Revolutionsflüchtling Pierre-Hippolyte-L. Paillot verbrachte auf der Flucht 1789 einige Wochen in Dorsten. In dieser Zeit besuchte er auch Lembeck und charakterisierte – zur gleichen Zeit wie Brunn – in seinem Tagebuch die Lembecker folgendermaßen:
„In Rücksicht der Sitten stehet der Bauer hier vor dem Landmanne in anderen Gegenden Deutschlands sehr zurück. Lebt er isoliert, entfernt von Städten und Ämtern […], sind die rauen Ecken seines Geistes durch das Militär nicht abgeschliffen, so hat seine Plumpheit und Grobheit den höchsten Grad erreicht. Eine höchst schmutzige und säuische Lebensart ist ihm zur Natur geworden. Er lebt mit Schweinen, Gänsen und Hühnern auf verschlossenen Stuben, die selten gereinigt werden […]. Die Menschen leben und sterben in ihrem eigenen Unrat. Daher dann die häufigen Anfälle von Dumpf- und Faulfieber und anderen Krankheiten […]. Durch die eingewurzelte Vertraulichkeit beider Geschlechter und die schamlose Unbefangenheit, womit auch die Eheleute von Dingen sprechen, die kein Ohr des Jünglings oder der Jungfrau hören sollte, wird unter dem Volke der Geschlechtstrieb zu früh entwickelt und in Gärung gebracht […].“ (Siehe Bevölkerung, Charakter, Lebensweise.)